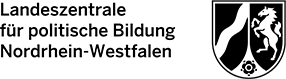Mehr als man kennt - näher als man denkt. Objektgeschichten aus Gedenkstätten in NRW.

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine vielfältige und mit großem Engagement getragene Gedenkstättenlandschaft.
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und –Erinnerungsorte in Nordrhein-Westfalen hat die Landeszentrale für politische Bildung die Ausstellung „Mehr als man kennt – näher als man denkt. Objektgeschichten aus Gedenkstätten in NRW“ entwickelt, um diese Vielfältigkeit abzubilden.
Mit den hier gezeigten Objekten geben die NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen einen sehr konkreten Einblick in ihre Arbeit – erstmals auch digital! In den Dauerausstellungen der Gedenkstätten sollen diese und andere Objekte zu Fragen anregen und zur Diskussion auffordern.

Bonn
Fast verloren stehen zehn bis zu 40 cm hohe und mehrere Kilo schwere verzierte Fragmente im gemeinsamen Foyer von Gedenkstätte und Stadtmuseum Bonn. Diese Bruchstücke stammen nicht aus dem Altertum oder dem Mittelalter, sondern sind Zeugen aus dem 19. Jahrhundert. Zeugen dafür, dass es in Bonn eine lebendige jüdische Gemeinde gab, die über Jahrhunderte zur Stadt und ihrer Geschichte gehörte. Zerschlagen, zerbrochen und verbrannt sind sie auch Zeugen der Verbrechen der Nationalsozialisten, des Leidens der Verfolgten und des Schweigens der Mehrheit.
Bruchkanten, Reste von Mörtel, fehlende Kanten und dunkle Verfärbungen auf den Fragmenten beweisen, dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes um Bruchstücke handelt. Sie gehörten in die Fassade der 1879 eröffneten Synagoge am Bonner Rheinufer. Wer die Dauerausstellung der Gedenkstätte für die Bonner Opfer des Nationalsozialismus besucht, kann auf einem Foto der Synagoge Bruchstücke wiederfinden. Sie schlossen als Kapitellen die Säulen vom Gebäude ab. Die anderen archäologischen Fundstücke gehörten unter anderem zu Randbögen.
Die Fragmente zeigen einige architektonische und künstlerische Details des vom königlichen Bauinspektor Eduard Hermann Mertens (1823–1898) in Form einer Basilika entworfenen Synagogenbaus. Die neoromanische Grundform des Gebäudes wurde mit den für den Synagogenbau jener Zeit typischen orientalisierenden Elementen verbunden. Der Bau besaß zwei rundbogige Ziergiebel an den Fassaden vor dem Satteldach mit Dekalogtafeln, Türmchen mit minarettartigen, von Davidsternen bekrönten Kuppelspitzen und Kuppelschirmen über den Eingängen.
Am Mittag des 10. November 1938 wurde die Synagoge angezündet, nachdem die NSDAP-Führung in der Nacht zuvor zu Gewalt und Brandstiftung gegen Juden im Deutschen Reich aufgefordert hatte. Auch andere Synagogen in Bonn wurden abgebrannt, dazu dutzende Geschäfte und Wohnungen von Juden verwüstet.
Zuerst löschte die Feuerwehr den Brand in der Synagoge am Rheinufer. Doch dann befahl der Bonner Polizeidezernent und SA-Führer Peter Reinartz, nur noch die umliegenden Häuser zu schützen. Mit tatkräftiger Hilfe von Bonner Bürgern wurde die Synagoge ein zweites Mal angezündet, dabei wurde sie vollständig zerstört. Schaulustige beobachteten den verheerenden Brand.
Bald darauf musste die jüdische Gemeinde den Abbruch ihres Gemeindehauses und ihrer Synagoge selbst organisieren und bezahlen. Kurze Zeit später kaufte die Stadt das brachliegende Grundstück.
Nach dem Krieg diente das ehemalige Synagogengrundstück als Parkplatz. Als dort ein Hotel gebaut werden sollte, nutzte 1987 das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland die Chance zu archäologischen Ausgrabungen. Tatsächlich konnten Fundamente der Synagoge freigelegt und jene Bruchstücke aus der Fassade gefunden werden. Nur ein Teil der östlichen Begrenzungsmauer blieb später am Originalstandort stehen. Aus den Steinen des Fundaments entstand im Auftrag der Stadt 1988 das Mahnmal am Moses-Hess-Ufer, an dem die jährlichen Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Novemberpogroms stattfinden. Der Rest einer Säule wurde 1990 neben der neuen Bonner Synagoge in der Tempelstraße aufgestellt.
Die zehn Fragmente wurden der Gedenkstätte übergeben, für die die Bruchstücke eine besondere Bedeutung haben. Denn sie sind nicht nur Teil der Erinnerung an die Zerstörung der Synagoge, sie verweisen auch auf die Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte. Schon vor Beginn der Bauarbeiten Mitte der 1980er Jahre wurde von der Stadtgesellschaft die Entstehung einer Gedenkstätte für die NS-Opfer gefordert. In der Folge gründeten engagierte Bürger 1984 einen Verein, der die Gedenkstätte Bonn bis heute trägt.

Brauweiler
Zwei Zellen, Wand an Wand, in jeder eine Pritsche mit Holzauflage. Durch eine schmale Öffnung in der Außenwand dringt nur wenig Licht in den engen Kellerraum ein, der auch zum vorgelagerten Gang hin vergittert ist, zusätzlich gesichert durch eine Holztür mit Sichtluke, die von außen geöffnet werden kann. Die Frauen, die im so genannten „Frauenhaus“ der Arbeitsanstalt Brauweiler inhaftiert waren, standen unter ständiger Beobachtung. Durch Einritzungen hinterließen sie zahlreiche Spuren auf den Zellenwänden.
Auch Auguste Adenauer, genannt Gussie, die zweite Frau von Konrad Adenauer, war in Brauweiler inhaftiert. Nach dem Attentatsversuch auf Adolf Hitler im Juli 1944 wurden mehr als 6.000 Personen im Rahmen der „Aktion Gewitter“ verhaftet. Zu ihnen zählte auch Konrad Adenauer. Das Regime wollte sich seiner politischen Gegner entledigen und nutzte dafür jede sich bietende Gelegenheit.
Zunächst auf dem Kölner Messegelände inhaftiert, dann in ein Krankhaus verlegt, gelang Konrad Adenauer mit der Hilfe von Freunden die Flucht in den Westerwald, wo er sich in einer kleinen Pension unter falschem Namen einquartierte und versteckt hielt. Im September 1944 wurde daraufhin seine Ehefrau festgenommen.
Unter der Drohung, ihre Töchter ebenfalls zu verhaften, sah sich Auguste Adenauer gezwungen, den Aufenthaltsort ihres Mannes zu verraten. Obwohl ihr zugesagt worden war, dass sie nach Preisgabe des Verstecks entlassen würde, wurde sie nach Brauweiler gebracht und blieb weiterhin in Haft. Verzweiflung wird es gewesen sein, die sie dazu führte, einen Selbstmordversuch zu unternehmen. Sie wurde rechtzeitig von einer Aufseherin gefunden und überlebte. Zehn Tage verbrachte sie in Brauweiler, bevor sie nach Hause zurückkehren durfte.Dass auch ihr Mann hier inhaftiert war, nachdem er im Westerwald aufgegriffen worden war, wusste sie nicht. Konrad Adenauer verbrachte etwa zwei Monate in Gestapo-Haft in Brauweiler, bevor er entlassen wurde. Schon kurz nach Kriegsende suchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Auguste den Ort ihrer Haft nochmals auf. Auguste Adenauer starb bereits 1948 im Alter von nur 52 Jahren.
Auguste und Konrad Adenauer waren zwei von insgesamt mehr als 1.000 NS-Gefangenen, die in den Jahren 1933 bis 1945 in Brauweiler inhaftiert waren.

Dingden
Ein Fahrrad ist für die meisten Menschen ein alltägliches Fortbewegungsmittel – und das war es bis zum 9. November 1938 auch für Ernst Humberg, einem jüdischen Viehhändler aus Dingden in Westfalen. Er war mit seinem Fahrrad und der Kornernte zu einem befreundeten Bauern gefahren, hatte das Korn gedroschen und als er damit fertig war, ließ er das Fahrrad eines platten Reifens wegen zurück. Die Reifenpanne sollte sein Leben retten.
Am Abend des 9. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen. Auf Anweisung führender Nationalsozialisten griffen SA-Gruppen jüdische Menschen und Einrichtungen an. Auch vor dem Haus von Ernst Humberg und seiner Familie versammelte sich die SA. Der hochschwangeren Hilde Humberg gelang es nicht, den Mob aufzuhalten. Aber ihr Protest zögerte das gewaltsame Eindringen hinaus. So konnte ihr Ehemann entkommen.
Ernst Humberg lief zu jenem Hof, wo sein Fahrrad stand. Dort erhielt er nicht nur Essen, Kleidung und Schuhe, sondern auch das Fahrrad zurück. Der Freund hatte den kaputten Reifen repariert. Auf dem Fahrrad floh Ernst Humberg in die Niederlande, wohin später auch Hilde mit der neugeborenen Tochter Ruth gelangte. Von dort aus emigrierte die Familie nach Kanada. Das Fahrrad nahm sie mit.
Das und vieles mehr aus dem Leben der Familie zeigt der Heimatverein Dingden e.V. im früheren Wohn- und Geschäftshaus der Familie Humberg.
Bei der Restaurierung kamen unerwarteter Weise zahlreiche Details der Hausgeschichte zum Vorschein. So ist neben Wandornamenten und Steinböden eine Privatmikwe erhalten, ein jüdisches Badebecken für rituelle Reinigungen. Daher gab der Verein seine ursprüngliche Absicht auf, die heimatgeschichtliche Ausstellung zu erweitern. Stattdessen wurde das Haus selbst, seine Geschichte und die seiner Bewohner und Bewohnerinnen zum Thema.
Am Beispiel der Familie Humberg lassen sich jüdisches Leben am Niederrhein und in Westfalen, ihre Stellung in der Dorfgesellschaft, die Zerstörung der Familie, die Verfolgung und Ermordung ihrer Mitglieder und der weitere Lebensweg der emigrierten Überlebenden und ihrer Nachkommen nachzeichnen. Zugang zu dieser Geschichte schaffen die Erinnerungen der Nachfahren und früherer Nachbarn – vor allem aber konkrete Alltagsgegenstände, die wieder ihren Platz im Humberghaus gefunden haben.
Dazu zählt auch das Fahrrad. Mehr als 70 Jahre nach der Flucht Ernst Humbergs fand es 2012 seinen Weg zurück nach Dingden. Ruth Humberg brachte es zur Eröffnung des Humberghauses mit. Dort erzählt es nun davon, wie aus einem alltäglichen Gegenstand ein Symbol werden kann: für Angst und Flucht, für Tod, Überleben und Neuanfang, aber auch für Freundschaft und Hilfe in der Nachbarschaft.
Von den sieben Geschwistern der Familie Humberg gelang nur dreien die Flucht und die Emigration nach Kanada: Ernst, seinem Bruder Siegmund und seiner Schwester Frieda. Die Geschwister Johanna, Wilhelm, Helene und Leopold wurden in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten ermordet.

Dorsten
Eins der schönsten Objekte im Jüdischen Museum Westfalen ist eine schwere Öllampe aus Messing, die von der Decke hängt. Sie sieht aus wie ein achtzackiger Stern, und in den Vertiefungen der Spitzen lagen früher die in Öl getränkten Dochte, die vor Schabbatbeginn am Freitagabend angezündet wurden und dann für mehrere Stunden ein warmes Licht spendeten.
Der Schabbat ist, nach Jom Kippur, der wichtigste jüdische Feiertag. In Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte wird er allwöchentlich als heiliger Ruhetag begangen. Am Schabbat soll keine Arbeit verrichtet werden. Als Arbeit galt in früheren Zeiten ganz zu Recht das Feuermachen. Während es heute ein Leichtes und sicherlich keine Arbeit mehr ist, mit dem Lichtschalter das Zimmer zu erhellen oder mit dem Thermostat die Heizung aufzudrehen, war das in alten Zeiten anders. Deshalb waren Schabbatlampen mit mehreren Lichtern eine nützliche Einrichtung.
Sie wurden, meistens mit fünf Sternspitzen, seit dem Mittelalter gefertigt und waren in jüdischen Haushalten bis zum 18. Jahrhundert üblich. Später zogen es die jüdischen Familien vor, zwei besondere weiße Kerzen anzuzünden. Wer aber eine alte Schabbatlampe besaß, pflegte sie als Familienerbstück weiterhin, auch wenn sie nicht mehr in Gebrauch war.
Auch die Dorstener Schabbatlampe stammt aus einem solchen Familienbesitz, nämlich aus dem Haus der Familie Steeg aus Daseburg bei Warburg. Ein Vorfahr, Samuel Steg, hatte über dreißig Jahre, von 1774 bis 1805, in Warburg als Rabbiner gewirkt. In seinem Haus begründete der gelehrte Mann eine „Jeschiwa“, eine Schule zum Studium der Tora und des Talmud.
Mit seiner Frau Schewa hatte Samuel Steg zwei Söhne, Menasse und Mordechai. Wie sein Vater widmete sich Mordechai dem Studium der Heiligen Schriften und studierte die Mystik der Kabbala. Sein Bruder Menasse hingegen heiratete Friederike, genannt Reike. Mit dem Geld, das sie als Gemüsebäuerin, als Bäckerin und mit ihrem Häute- und Fellhandel verdiente, konnte sie die ganze Familie ernähren.
Ein Nachfahre der Familie, Max Steeg, betrieb in den 1920er Jahren einen Kolonialwarenhandel in Daseburg. Aber 1937 entschloss er sich unter dem Druck der Nationalsozialisten, mit seiner Frau Bertha und dem Sohn Heinz nach Palästina zu flüchten. Geschäft und Wohnung hatten sie verkaufen und zurücklassen müssen, nur einige wenige Dinge nahmen sie mit auf die Reise – darunter auch die Schabbatlampe, die nun in der neuen Heimat einen Ehrenplatz bekam.
In Israel heiratete Heinz Steeg die aus Galicien stammende Alicia. 1960 kehrte das Paar nach Deutschland zurück und ließ sich in Frankfurt am Main nieder – auch die Schabbatlampe aus Daseburg wurde wieder ausgepackt.
Doch 15 Jahre später entschieden sich die Steegs zu einer Auswanderung nach Brasilien, und wieder kam die Schabbatlampe mit auf die Reise. Nach dem Tod von Heinz Steeg im Jahr 2005 kehrte seine Witwe nach Frankfurt zurück – mit der Schabbatlampe im Gepäck. Als auch Alicia Steeg gestorben war, bestattete man sie wunschgemäß auf dem jüdischen Friedhof in Daseburg. Ein Verwandter bewahrte die weitgereiste Lampe auf, bis er sie 2018 dem Jüdischen Museum Westfalen schenkte.

Diese beschädigte Taschenuhr ist nur eins von vielen Fundstücken, die 1954 im Rahmen einer Umbettung menschlicher Überreste in der Dortmunder Bittermark gefunden wurde. Sie gehörte wahrscheinlich einem der sowjetischen Häftlinge, die noch kurz vor Kriegsende von der Gestapo erschossen worden waren.
Darauf deutet vor allem die russische Widmung hin, die auf der Rückseite eingraviert ist und bedeutet: „Geschenk des Bruders zum Tag des Wiedersehens 13. November 1943“. Was mag der „Tag des Wiedersehens“ – oder auch „des Treffens“ bedeuten? Was ist am 13. November 1943 geschehen? Und wo hatte diese Begegnung stattgefunden? Wir wissen nichts über den Menschen, dem diese Uhr einmal gehörte.
Aber wir wissen, dass die Dortmunder Gestapo im März und April 1945, nur ganz kurz vor Befreiung der Stadt in mehreren Massenerschießungen insgesamt etwa 230 Menschen exekutiert hat. Die meisten waren sowjetische Zwangsarbeiter*innen, die im NS-Staat als „Untermenschen“ galten und extremen Lebens- und Arbeitsbedingungen unterworfen waren. Verschärft wurden die Verhältnisse durch die alliierten Luftangriffe, denen die Arbeiter*innen weitgehend schutzlos ausgeliefert waren. Die Folge waren zahlreiche Fluchtversuche und andere Vergehen, um das Leben erträglicher zu machen. So waren die „Ostarbeiter*innen“ ab 1942/ 1943 die größte Gruppe im Dortmunder Polizeigefängnis Steinwache und auch in anderen Haftstätten. Massive Gewalt ihnen gegenüber gehörte zum Alltag. Delikte, die als besonders schwer bewertet wurden, bestrafte die Gestapo mit dem Tod.
Mit den immer dichteren Intervallen der Bombardierungen, der weiteren Zerstörung der Städte und vielen neu eintreffenden „Ostarbeiter*innen“ eskalierten die Zustände. Immer brutaler reagierte die Gestapo. Höhe- und gleichzeitig Schlusspunkt der Gewalt waren die vorher meist in KZ durchgeführten Gruppenexekutionen in den letzten Kriegswochen, im Rahmen derer nun auch schwerer Vergehen beschuldigte deutsche und westeuropäische Häftlinge, die die Gestapo weder wie zuvor der Justiz überstellen noch aus dem von amerikanischen Truppen eingeschlossenen Ruhrgebiet evakuieren konnte, erschossen wurden. Was passierte nach dem Krieg? Schon bald errichtete man auf Initiative vor allem kommunistischer Akteur*innen an einem der Exekutionsorte im Wald der Bittermark im Süden Dortmunds ein erstes Mahnmal. Aber erst 1954 legte man einen „Ehrenhain“ an, wohin man die zunächst auf Dortmunder Friedhöfen beigesetzten Opfer umgebettete. 1960 schließlich wurde ein neues, bis heute bestehendes Mahnmal fertiggestellt. Es ist sicherlich eine Besonderheit, dass in Dortmund hier jedes Jahr ausgerechnet am Karfreitag, dem höchsten protestantischen Feiertag, eine Gedenkveranstaltung durchgeführt wird, unter größter Beteiligung von Bürger*innen und gewidmet vor allem den bisher identifizierten und als „Widerstandskämpfer*innen“ geehrten deutschen und französischen Opfern.
Dass es aber in der Mehrheit osteuropäische, namenlose Arbeitssklaven waren, die dem Terror der deutschen Polizei an der „Heimatfront“ zum Opfer fielen, muss diese verrostete Uhr erzählen, die heute in der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache, dem ehemaligen Dortmunder Polizeigefängnis, gezeigt wird.

Drensteinfurt
In der ehemaligen Synagoge Drensteinfurt, einer Gedenkstätte, wird neben wenigen historischen Fotografien und Büchern auch ein Modell 1:50 der Synagoge verwahrt und gezeigt. 20 Schülerinnen und Schüler der damaligen Städtischen Realschule Drensteinfurt haben es im Schuljahr 2008/2009 gefertigt. Ihre Namen sind auf einer außen aufgeklebten Edelstahlplatte festgehalten.
Es ist eine Holzarbeit in Sperrholz und Vollholz. Der dargestellte Synagogenraum hat eine Bodenplatte sowie vier Wände, jedoch keine Decke. Man kann das Modell also von oben betrachten, man könnte jedoch auch durch die Türöffnung und Fensteröffnungen hineinsehen. Über der Tür ist ein Oberlicht in vier halbkreisförmig angeordneten offenen Segmenten erkennbar.
Das wesentliche bis heute vorhandene Gestaltungselement in dem kleinen und kargen Raum ist die Frauenempore. Sie wird über eine vielstufige, den Viertelkreis beschreibende Holztreppe bestiegen. Das Modell hat hier oben eine Sitzbank, unten hat es drei Sitzbänke. An der Brüstung der Empore zum Synagogenraum hin lässt sich eine Kassettenstruktur als Reliefierung ausmachen. An der Stirnwand befindet sich ein hoher Thoraschrein zur Aufbewahrung der Thorarollen. Die dargestellte Szene zeigt eine Person als Vorbeter mit ausgebreiteten Armen vor einem Lesepult mit aufliegender Thorarolle. Auf einem Seitentisch unter dem Fenster zur Straße liegt ein großes geschlossenes Buch.
Wenige weitere Personen befinden sich in der Synagoge. Zwei Figuren stehen in der Nähe des Eingangs. Zwei Personen sitzen auf den unteren Bänken, eine Person sitzt auf der Emporenbank. Zwei Fensteröffnungen befinden sich an der der Tür gegenüber liegenden Wand. Eine Fensteröffnung liegt an der Straßenseite, die vierte hinter der Empore. Die vier Fensteröffnungen schließen jeweils oben bogenförmig.
In der Herstellung des Modells haben die Schülerinnen und Schüler sicherlich vieles über jüdische Glaubenspraxis und Sozialordnung lernen können. Wer das Modell betrachtet, sieht anderes als in dem sehr schlicht gehaltenen Synagogenraum. Hier, in der heutigen ehemaligen Synagoge, befinden sich mobile Stühle für Besuchergruppen. Neben der nagelfesten Empore hat sich vom Inventar nichts erhalten. Die heutige Raumwirkung ist umso größer.

Duisburg
Ein schwerer, unscheinbarer Holzkoffer, auf den ersten Blick unverdächtig – und doch entfaltet er sich im wahrsten Wortsinn zu einer zweckdienlichen "Waffe" im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Aufgeklappt wird seine Funktion erkennbar: Es ist ein Abzugsapparat für die heimlich auf Matrizen verfassten illegalen Schriften. Blatt für Blatt wird auf die Fläche gelegt, der Rahmen mit dem beschrifteten Wachsbogen heruntergeklappt und auf das Leinwandtuch zähflüssige schwarze Farbe gerollt. Flugblätter, Plakate, aufklärerische und propagandistische Texte des linken Widerstands, wie der "Rote Förderturm" der Duisburger KPD und andere entstehen so in mühevoller Handarbeit. Nachts, in der Hinterstube einer Bäckerei der Duisburger Innenstadt oder in anderen Ad hoc-‚Druckereien‘. Die Schriften werden sofort verteilt, in Briefkästen geworfen oder unter der Tür hindurchgesteckt. Sie finden den Weg auf die Zeche und unter Tage, auf das Fabrikgelände, - und werden vom Wind zerstreut.
Ein "Tatwerkzeug" des Widerstands, das über alle Jahrzehnte von überlebenden Widerstandskämpfern wie ein Augapfel gehütet wurde, wird zum wichtigen Exponat zunächst in der Ausstellung der VVN/Bund der Antifaschisten Duisburg, dann in der Sonderausstellung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie (ZfE) "Das Rote Hamborn – Politischer Widerstand in Duisburg von 1933 bis 1945". Diese Ausstellung war die zweite des ZfE. Eine erste Präsentation widmete sich von 2015 bis 2016 dem jüdischen Leben in Duisburg von 1918 bis 1945 unter dem Titel "Noch viele Jahre lang habe ich nachts von Duisburg geträumt".
Mit seinen Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen, Stadtrundgängen und Lesungen wendet sich das 2014 unter Leitung des Kultur- und Stadthistorischen Museums und des Stadtarchivs Duisburg gegründete ZfE an eine breite Öffentlichkeit. Es entspricht seiner Aufgabe, die NS-Geschichte der Stadt Duisburg forschend aufzuarbeiten und zu vermitteln. Für Studierende und insbesondere für Schülerinnen und Schüler bietet das ZfE Work-shops zu unterschiedlichen Themen an. Dabei setzt die Arbeit des ZfE stets bei konkreten Einzelbiographien an (von Opfern, aber auch von Tätern) und eröffnet über Anknüpfungspunkte z.B. in den Stadtteilen und Straßenzügen oder durch Gebäude anschauliche und auch emotionale Zugänge zur Stadtgeschichte. Das Zentrum unterhält mehrere Bildungspartnerschaften mit Duisburger Schulen und unterstützt die erinnerungskulturelle Arbeit der Schulen etwa bei der Verlegung von Stolpersteinen, bei Schulprojekten und Gedenkveranstaltungen.
Derzeit entwickelt das ZfE eine Dauerausstellung zur Geschichte Duisburgs im Nationalsozialismus. Im Gebäudekomplex des Kultur- und Stadthistorischen Museums und des Stadtarchivs Duisburg werden in den kommenden Jahren durch Umbaumaßnahmen die räumlichen Voraussetzungen für eine Ausstellungsfläche von ca. 400 qm geschaffen, die an die bestehende stadtgeschichtliche Ausstellung des Museums anbindet.
Seit 2017 entwickelt sich die Migrationsgeschichte zu einer neuen thematischen Säule des ZfE. Wie alle Gedenkstätten und Erinnerungsorte, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet, sieht sich auch das ZfE mit der Aufgabe konfrontiert, die NS-Geschichte Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu vermitteln. Das ZfE bemüht sich darum, ein gemeinsames Bewusstsein für die Stadtgeschichte zu entwickeln und die migrationsgeschichtliche Perspektive konsequent in die stadtgeschichtliche Arbeit zu integrieren – auch in die Aufarbeitung der NS-Geschichte z.B. bei Themen wie der jüdischen Migration aus Osteuropa oder der Zwangsarbeit.

Düsseldorf Erinnerungsort Alter Schlachthof
„Dann standen wir die ganze Nacht im Schlachthof herum. Der Boden war nass, es war kalt, und die Feuchtigkeit kroch die Glieder hoch... In den Steintrögen des Schlachthofs lagen Babys und Kleinkinder und weinten die ganze Nacht... Gegen vier Uhr morgens wurden wir hinausgeführt. Es war sehr kalt, und wir drängten uns aneinander, um uns gegenseitig zu wärmen".
So beschreibt die Holocaust-Überlebende Hilde Sherman-Zander aus Mönchengladbach die Nacht, die sie in der Großviehmarkthalle des Düsseldorfer Schlachthofs verbringen musste. Sie war damals 18 Jahre alt, ihr Mann Kurt Winter, den sie kurz zuvor geheiratet hatte, 29 Jahre. Am nächsten Morgen wurden sie mit über 1.000 anderen jüdischen Menschen aus der Region in das von der deutschen Wehrmacht besetzte Lettland deportiert, genauer: in das Ghetto Riga. Kurt überlebte den Holocaust nicht.
Heute befindet sich in derselben Halle die Bibliothek der Hochschule Düsseldorf. Die neben Bücherregalen und Computer-Arbeitsplätzen ausgestellten, original erhaltenen Steintröge haben eine hohe symbolische Bedeutung. Sie erinnern daran, dass dieser Ort einmal Teil des Schlachthofs war. Zugleich sind sie, abgesehen von der Halle selbst, das einzige Exponat, das konkret an die Verbrechen der Deportationen erinnert. Sie sind ein Mahnmal, das am historischen Ort an alle Menschen erinnert, die infolge des nazistischen Rassenwahns ermordet wurden.
Die frühere, denkmalgeschützte Großviehmarkthalle ist ein bedeutender historischer Ort für die gesamte Region. Sie war in den Jahren 1941-1944 die zentrale Deportationssammelstelle des gesamten Regierungsbezirkes Düsseldorf. Fast 6.000 jüdische Frauen, Männer und Kinder mussten sich auf Anordnung der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) hier einfinden. Es waren insgesamt sieben Deportationen, die meisten in den Jahren 1941/42. In der Halle, wo sonst das Vieh auf seine Schlachtung wartete, wurden die Menschen von Gestapobeamten registriert, nach Wertgegenständen und Lebensmitteln durchsucht und beraubt. Voller Ungewissheit vor dem Kommenden mussten sie die Nacht in der Halle verbringen.
Bewaffnete Polizisten brachten die Menschen am nächsten Morgen zur Verladerampe des nahe gelegenen Güterbahnhofs, von wo sie deportiert wurden: in die Ghettos von Łódź, Minsk, Riga, Izbica und Terezín. Die Fahrkarten der Reichsbahn mussten sie selbst bezahlen. Die meisten von ihnen wurden ermordet. Viele starben aufgrund der bewusst von der deutschen Besatzungsmacht herbeigeführten Lebensbedingungen an Unterernährung, Entkräftung und Krankheiten. Nur etwa 300 Menschen überlebten ihre Deportation.
Bis 2002 war der Schlachthof in Betrieb, danach verwaiste das Gelände, bis dort 2016 der neue Campus der Hochschule gebaut wurde. Im Eingangsbereich der Halle, von außen gut sichtbar und für alle zugänglich, dokumentiert seitdem eine Dauerausstellung die an diesem historischen Ort verübten Verbrechen und erinnert an die Verfolgten und Ermordeten: der Erinnerungsort Alter Schlachthof.

Aus Holz gefertigt und etwas ramponiert liegt er da: ein gewöhnlicher Staffelstab, wie man ihn aus der Leichtathletik kennt. Bei Gruppenwettkämpfen wird er von Läufer zu Läufer weitergegeben. Doch so unscheinbar der Holzstab aus der Dauerausstellung der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf zunächst wirken mag, er hat eine bewegende Reise hinter sich: Im Gepäck eines Jugendlichen gelangte der Staffelstab im Februar 1939 von Düsseldorf nach England.
Sein Besitzer Rudi Löwenstein war ein deutsch-jüdischer Sportler. Mit einem „Kindertransport“ floh er vor den Nationalsozialisten. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er als „feindlicher Ausländer“ interniert und nach Kanada in ein Gefangenenlager überführt. Erst im Mai 1942 kam Rudi Löwenstein frei. Er lebte bis zu seinem Tod 2004 in Kanada. Den Staffelstab behielt er. Schließlich erinnerte dieser ihn an drei gute Freunde aus Düsseldorf: Kurt Eckstein, Heinz Jokl und Werner Philipp.
Die vier Jugendlichen hatten eines gemeinsam. Als Juden wurden sie von den Nationalsozialisten diskriminiert und verfolgt. Der Sport bot ihnen die Möglichkeit, die ausgrenzenden Sprüche und beängstigenden Angriffe wenigstens für ein paar Stunden zu vergessen. Alle vier wurden Mitglied in der Sportabteilung des „Reichsbunds Jüdischer Frontsoldaten“. Bei einem Leichtathletik-Wettkampf in Köln am 19. Juni 1938 traten sie zum letzten Mal gemeinsam an. Anschließend setzte die Pogromnacht vom 9. November 1938 dem jüdischen Sportverein endgültig ein Ende.
Rudi Löwenstein war der erste der vier Jugendlichen, dem es gelang, das nationalsozialistische Deutschland zu verlassen. Sein Freund Kurt Eckstein versuchte 1939 ebenfalls nach England zu entkommen. Doch alle Versuche waren vergebens. Am 10. November 1941 wurde er genau wie sein Freund Heinz Jokl von der Geheimen Staatspolizei nach Minsk deportiert. Im gleichen Deportationstransport befanden sich auch die Eltern und die ältere Schwester von Werner Philipp. Werner selbst konnte Deutschland hingegen noch rechtzeitig verlassen.
Werner Philipp und Rudi Löwenstein blieben zeitlebens in Kontakt. 1993 besuchten sie gemeinsam ihre frühere Heimatstadt. Den Staffelstab brachten sie mit und schenkten ihn der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Sie wollten verhindern, dass das Schicksal ihrer ermordeten Freunde in Vergessenheit gerät.
Die Gedenkstätte erforscht und dokumentiert die Ereignisse in Düsseldorf in den Jahren von 1933 bis 1945. Neben der Suche nach Dokumenten und Fotos in Archiven steht hierbei vor allem der Kontakt zu Zeitzeugen, Überlebenden und deren Nachfahren im Vordergrund. Die Reise des kleinen Holzstücks ist hier zu Ende. Mit folgender Widmung hat der Staffelstab einen festen Platz in der Dauerausstellung „Düsseldorfer Kinder und Jugendliche 1933 bis 1945“ erhalten:
„In schmerzlich ehrendem Andenken an unsere von den Nazis ermordeten Staffelkameraden Kurt Eckstein (*2. Juli 1923 in Düsseldorf; gest. in Auschwitz) und Heinz Jokl (*28. Februar 1923 in Düsseldorf – gest. in Minsk) und an alle anderen Sportfreunde“.

Essen
Im Ausstellungsteil „Geschichte des Hauses“ finden sich Mosaiksteine vom Torahschrein und Glasscherben, die von der damals elfjährigen Doris Moses in der ausgebrannten Synagoge aufgesammelt worden sind.
Doris Moses wurde 1927 in Viersen geboren. Ihre Eltern waren Arthur Moses und Meta Moses, geb. Katz, ihr zwei Jahre jüngerer Bruder hieß Günther. 1930 zog die Familie nach Essen, wo ihr Vater als Geschäftsführer in einem EPA-Warenhaus in der Innenstadt arbeitete. Nachdem er 1933 entlassen wurde, machte er sich als Vertreter einer Firma für industrielle Putzwaren selbstständig. Diese Stellung verlor er 1937 und war von da an arbeitslos. Obwohl Doris noch klein war, bemerkte sie, dass ihre Eltern große Sorgen hatten. Die Familie plante, in die USA auszuwandern. Sie hatten zwar eine niedrige Registrierungsnummer und sogar ein Affidavit, aber die Bürgschaft war nicht hoch genug.
Nach der Pogromnacht, am Morgen des 10. November 1938, bemerkte Doris auf dem Weg zur Schule, dass die Synagoge ausgebrannt und die Fenster im Sockelgeschoss zerstört waren. Wie andere Kinder kletterte auch sie durch ein zerbrochenes Fenster in den verwüsteten Hauptraum der Synagoge, in dem Schutt, Scherben und verbrannte Fetzen von Torah-Rollen und Gebetbüchern lagen. Dort sammelte sie eine Handvoll Mosaiksteinchen und Glassplitter und nahm sie mit. Ihr Vater hatte inzwischen eine Warnung erhalten, dass man ihn suchte, und versteckte sich zwei Wochen lang bei befreundeten Bauern in Geldern. Danach flüchtete die Familie illegal über die Grenze in die Niederlande, wo sie sofort interniert wurde. Schon bald kam sie in das 1939 gegründete Flüchtlingslager Westerbork, das unter den Nationalsozialisten zum „Polizeilichen Juden-Durchgangslager Westerbork“ und damit zum Ausgangspunkt für die Deportationen nach Auschwitz, Sobibór, Theresienstadt und Bergen-Belsen wurde.
Doris war in Westerbork zunächst zur Lager-Schule gegangen, doch 1942, mit der Umwandlung in ein Durchgangslager und dem Beginn der Deportationen musste sie, wie die Erwachsenen, schwer arbeiten. 1944 wurde die Familie nach Theresienstadt deportiert. Arthur Moses wurde nach wenigen Wochen von dort aus nach Auschwitz weiter transportiert, wo er im Februar 1945, als er auf dem Marsch vom Lager zum Arbeitseinsatz vor Schwäche nicht mehr weitergehen konnte, erschossen wurde.
Nach der Befreiung gingen Meta Moses und ihre Kinder zurück nach Holland. Da sie Verwandte in Australien hatten, emigrierten sie dorthin.
Die Mosaiksteinchen gingen während dieser ganzen Zeit nicht verloren. Sie waren Doris und ihrer Mutter immer besonders wichtig, weil sie sie an glückliche Zeiten erinnerten. Doris selbst schrieb, dass die Synagoge ihr zweites Zuhause gewesen war.
Im Jahr 1988 wurde Doris Moses von der Stadt Essen eingeladen. Dies geschah im Rahmen des Besuchsprogramms für jüdische ehemalige Essener, das seit 1981 durchgeführt wurde. Zu diesem Anlass brachte sie die Mosaiksteine mit und überließ sie der Alten Synagoge. Auch ihre zwei Poesiealben hatte sie mitgebracht, die heute, ebenso wie ein Foto der Familie Moses, im Ausstellungsteil „Jüdisches Leben in Essen“ zu sehen sind. In einem schrieb ihr die Freundin Marion Bierhoff am 9. November 1938, dem Tag, an dessen Ende die Synagoge, das jüdische Jugendheim und andere Geschäfte und Häuser angezündet wurden, folgenden Spruch ins Album:
„Rede wenig, aber wahr, vieles Reden bringt Gefahr.“

Gelsenkirchen
„Ein Volk - Ein Reich - Ein Führer“. Auffälliger hätte das NSDAP-Parteiprogramm von 1920 an den Wänden einer ehemaligen Parteidienststelle in Gelsenkirchen kaum angebracht worden sein. Bebildert mit einem Portrait Adolf Hitlers strahlte den Funktionären und Besuchern der NSDAP-Ortsgruppe Buer-Erle in roten und schwarzen Buchstaben mehr als vier Meter hoch und fünf Meter breit entgegen, was die Nationalsozialisten seit ihrer Gründungszeit noch lange vor ihrer Machtübernahme 1933 forderten.
Vermutlich um 1937 ließ der damalige Ortsgruppenleiter Franz Switala die Wandinschrift in dem Gebäude an der Cranger Straße in Gelsenkirchen anbringen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Nationalsozialisten auch die der lange sozialdemokratisch und kommunistisch geprägten Industriestadt im Ruhrgebiet ihre Macht mit Gewalt gegen Andersdenkende und Anreizen für die „Volksgenossen“ gesichert.
Und dennoch galt es auch 1937 noch, regelmäßig die Allgegenwärtigkeit und Bedeutung der Partei unter Führung Hitlers vor Augen zu führen. Dieses 25-Punkte-Programm war völkischer Natur. Es lehnte den Kapitalismus als Weltverschwörung ab, schürte aber vor allem nationalistische und rassistische Vorurteile gegenüber Menschen, die anders dachten, einer anderen Religion angehörten oder eine andere Herkunft hatten. Deutlich war in diesem Par-teiprogramm von 1920 schon zu erkennen, was während des Zweiten Weltkriegs grausame Wirklichkeit wurde: Die Vorstellung der Nationalsozialisten, durch millionenfachen Mord an Juden eine andere Gesellschaft zu formen. Doch auch die Widersprüche der nationalsozialistischen Ideologie zeigten sich schon hier.
Ob die Wirkung der Wandinschrift tatsächlich derart groß war, wie die Berichte der Natio-nalsozialisten es behaupteten, wissen wir heute nicht mehr. Denn politisch hatten die Punkte des Parteiprogramms von 1920 Ende der 1930er Jahre keine besondere Bedeutung mehr. Vielmehr sollte die Wandinschrift die „Kampfzeit“ gegen das verhasste „System“ und dem „Bolschewismus“ erinnern. Die Allmacht des „Führers“ Adolf Hitler löste die Bedeutung des Programms ab.
Das Gebäude an der Cranger Straße war 1907 als Polizeirevier für die Gemeinde Buer errichtet worden und wurde nach der Machtübernahme 1933 von der NSDAP Ortsgruppenleitung Buer-Erle genutzt. Die Wandinschrift hatte hier eine doppelte Funktion. Wer sich in der Dienststelle aufhielt, sollte so die Ziele der NSDAP verinnerlichen. Daneben sollte sie ganz einfach den Arbeitsplatz dekorieren. Die Aussage eines Parteimitgliedes, ihm hätte die Wandinschrift so viel Freude bereitet, dass er die Dienststelle am liebsten gar nicht mehr verlassen hätte, ist sicherlich übertrieben. Und doch geht aus einem Artikel über die Ortsgruppe Buer-Erle in der „National-Zeitung“ von 1938 hervor, dass sich Ortsgruppenleiter Switala auf die tatkräftige Unterstützung seiner Mitglieder verlassen konnte, um die 25 Punkte an die Wand zu bringen.
Nach dem Ende der NS-Herrschaft 1945 nutzten unterschiedliche Institutionen das Gebäude. Bis 1976 befanden sich eine Polizeidienststelle im Haus, zwischenzeitlich auch eine Sparkassenfiliale und eine Meldestelle. Ab 1980 war eine Zweigstelle der Stadtbibliothek dort untergebracht. Die Wandinschrift war übrigens schon nach Kriegsende 1945 verputzt worden und blieb auf diesem Weg bis zu ihrer Wiederentdeckung im Jahr 1986 weitgehend erhalten. Zu diesem Zeitpunkt nutzte eine Gruppe Gelsenkirchener Schriftsteller die Räume.
Im Februar 1989 stellte der Stadtrat die Wandinschrift unter Denkmalschutz. Mit Zuschüssen des Landes NRW konnte schließlich die Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ an einem historisch authentischen Standort verwirklicht werden. Das 1989 gegründete Institut für Stadtgeschichte eröffnete 1994 in den Räumen an der Cranger Straße eine erste Dauerausstellung. Seitdem setzt sich die Einrichtung mit der lokalen NS-Geschichte auseinander.

Hemer
An ihr Spielzeug erinnern sich Erwachsene selbst nach Jahrzehnten noch gerne. Im Krieg waren Objekte wie die selbst geschnitzten pickenden Hühner etwas ganz Besonderes. Da störten auch kleine Ungenauigkeiten bei der Ausführung wenig. Hauptsache, die Mechanik funktionierte und man konnte an dem Spielzeug etwas bewegen!
Dafür ist das kleine, kaum 17 cm breite und 6 cm hohe Spielzeug aus der Ausstellung der Gedenkstätte Stalag VI A ein Musterbeispiel: Aus rohem Holz grob geschnitzt und unbemalt besticht es bei aller Einfachheit durch seinen Bewegungsmechanismus. An den beiden Holzleisten sind die Hühner mit Nägeln so befestigt, dass sie durch Hin- und Herschieben der unteren Leiste abwechselnd auf den Pilz in der Mitte picken.
Geschnitzt hat das Spielzeug ein sowjetischer Kriegsgefangener des Stalag VI A. Die Essensrationen im Lager und in den meisten Arbeitskommandos waren gerade für die sowjetischen Gefangenen viel zu gering und von schlechter Qualität. Es reichte kaum zum Überleben. Es war deshalb pure Not, die vor allem die sowjetische Kriegsgefangenen dazu trieb, mit viel Geschick und Geduld, aber auch Hingabe nur mit Hilfe von einfachsten Werkzeugen kleine Gegenstände aus gesammeltem Abfallmaterial wie Stroh, Holz und Metall herzustellen. Ihre Bastelarbeiten boten sie dem Lagerpersonal und auch der Zivilbevölkerung zum Tausch gegen Nahrungsmittel und Medikamente an – oder sie bedankten sich auf diese Weise für eine gute Behandlung, die nicht der Regelfall war.
Das Stalag VI A war eines der großen Kriegsgefangenenlager im Deutschen Reich im Zweiten Weltkrieg. Im Herbst 1944 verwaltete das Stalag VI A fast 100.000 sowjetische Kriegsgefangene – reichsweit die höchste Zahl bei den Stalags. Als am 14. April 1945 amerikanische Truppen das Stalag VI A befreiten, lebten dort noch 23.000 Kriegsgefangene. In der Zeit von Oktober 1939 bis Ende 1945 sind rund 11.000 Menschen im Stalag bzw. nach dem Ende des Stalags in Lazaretten an Hunger, Krankheiten, Kriegsverletzungen und Willkürakten der Bewacher umgekommen.
Die Bastelarbeiten der Gefangenen – oft einfache Gebrauchsartikel, Ziergegenstände oder eben Kinderspielzeug – waren bei der Bevölkerung beliebt, denn so etwas gab es in der Regel nicht mehr zu kaufen. An manchen Orten florierten regelrechte Tauschmärkte, ohne dass die Hersteller dabei immer auf eine faire Bezahlung rechnen konnten. Von offizieller Seite indes war dieser Handel verboten: Für die deutsche Bevölkerung galt er als „verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen“. Die Regierung sah darin eine unerwünschte Annäherung zwischen deutschen „Volksgenossen“ und den als „rassisch“ nicht ebenbürtigen Kriegsgefangenen sowie eine Gefährdung der Staatssicherheit. Seit August 1944 unterband die Polizei den Tauschhandel im gesamten Wehrkreis VI.
In einigen Familien wurden die sorgfältig und mühsam angefertigten Tauschobjekte aufbewahrt und nach einem Aufruf des „Vereins für Hemeraner Zeitgeschichte“ der Sammlung der Gedenkstätte Stalag VI A zur Verfügung gestellt. Man wusste, dass diese einzigartigen und berührenden Objekte dort sorgsam für die nächsten Generationen als Anschauungsobjekte für die Kreativität und Hingabe von Menschen selbst in härtesten Kriegs- und Notzeiten aufbewahrt werden. Die „Pickenden Hühner“ sind bis heute überliefert. Vom weiteren Lebensweg des Mannes indes, der sie an vielleicht vielen Abenden heimlich geschnitzt hat, wissen wir nichts.

Herford
Was anderswo als Sachbeschädigung gilt, ist im Keller des Herforder Rathauses eine bedrückende Spur in die Vergangenheit: In eine der Holztüren des früheren Polizeigefängnisses hat jemand voller Hoffnung den Satz geritzt: „Es geht alles vorüber.“ Ursprünglich hatte das 1917 in Betrieb genommene Polizeigefängnis aus zehn Zellen von je neun bis zwölf Quadratmetern bestanden. Eine diente später als Toilette, eine als Waschraum, eine als Verhörzelle. Die anderen blieben bis 1964 Hafträume.
Das Gefängnis war für die Abbüßung kleinerer Vergehen und die Unterbringung von Untersuchungshäftlingen gedacht. Dieser Zweck änderte sich nach 1933. Nun konnte auch die Gestapo, die Politische Polizei der Nationalsozialisten, Menschen einweisen. Das waren von Anfang an Gegner des neuen Regimes: Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter. Nach dem Beginn des Krieges 1939 mit dem Überfall auf Polen, vor allem nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion 1941, verhaftete die Gestapo auch ausländische Zwangsarbeiter. Sie galten der deutschen Führung als „Untermenschen“ und besaßen keine Rechte. Schon wegen geringfügiger Verstöße konnten sie in Haft genommen werden.
So zum Beispiel auch Agnesa Apasanenko, geboren 1925 in Mariupol (Shdanow), einer ukrainischen Stadt im Donezk. Anfang 1942 verschleppten die Deutschen die Siebzehnjährige aus ihrer Heimat nach Herford zum Arbeitseinsatz. Auch sie hinterließ – in der Tür ihrer Zelle Nummer Zwei – in kyrillischer Schrift ein sprechendes Dokument ihrer Haft: „Agnesa Apasanenko aus Mariupolja saß in dieser Kammer 15 Tage lang. Kam an im Jahr 19.3.1945. Seit meinem Aufenthalt in Deutschland saß ich in dieser Kammer 2-mal".
Im Oktober 1942 verließ Agnesa Apasanenko ohne Erlaubnis ihre Arbeitsstelle bei der Firma Rottmann in Herford, um ihren Bruder in Bad Meinberg zu besuchen. Das wurde ihr zum Verhängnis. Nach der Haft kehrte sie zu ihrem Arbeitgeber zurück und wurde im April/Mai 1945 in die Sowjetunion zurücktransportiert.
Als die Polizeibeamten und Aufseher erkannten, dass der Krieg nicht zu gewinnen war, begannen sie mit der systematischen Vernichtung von Akten, die sie belasten könnten. Obwohl viele Quellen fehlen, ist es Mitarbeitenden der Herforder Gedenkstätte in akribischer Forschungsarbeit anhand erhaltener Akten und im Gespräch mit Zeitzeugen gelungen, einige Fakten zu recherchieren: Die Haft konnte bis zu sechs Monaten dauern, aber in der Regel handelte es sich nur um wenige Tage. Die spärlich ausgestatteten Zellen waren meistens mit zwei bis vier, zuweilen aber auch mit sechs Personen belegt.
Und es ist gelungen, die Identität der meisten Opfer zu klären, die hier gefangen und der Willkür der Gestapo und Kriminalpolizei ausgeliefert waren: politische Gegner des Regimes, Juden, die „Ernsten Bibelforscher“ (heute: Zeugen Jehovas), homosexuelle Männer, sogenannte „Asoziale“. Für sie alle waren die Zellen ein Ort der Ungewissheit und Angst, des Hungers, der Folter und Schmerzen, für manche eine Station auf dem Weg in ein Konzentrationslager. Oder sogar zum Todesurteil vor Gericht. Ob sich die Hoffnung, dass „alles vorübergeht“, bewahrheitete, ist nicht bekannt.
Agnesa Apasanenko hat überlebt: 1994 besuchte sie gemeinsam mit weiteren 21 früheren Zwangsarbeiterinnen aus Mariupol auf Einladung der Stadt Herford den Ort ihrer Polizeihaft, aber damals waren ihre Spuren im Zellentrakt noch nicht entdeckt. Heute sind die Einritzungen in den Türen des Herforder Zellentrakts erschütternde physische Spuren des Leidens. Sie dokumentieren aber auch den unbedingten Willen zum Leben und die Hoffnung der Opfer und sind damit ein bedeutendes Vermächtnis an die Nachgeborenen.

Köln (NS-Dokumentationszentrum)
Ob im Krankenhaus, in Behörden oder in Einrichtungen der Altenpflege: Fast jeder Mensch in Deutschland hat sich schon einmal die Hände unter einem Desinfektionsapparat eingesprüht. Wo Menschen gemeinsam den Alltag gestalten, soll Desinfektion normalerweise verhindern, dass sich Keime ausbreiten und der gemeinsame Alltag zusammenbricht.
Auch der im NS-Dokumentationszentrum in Köln ausgestellte Desinfektionshandapparat war ein alltäglich genutzter Gegenstand zur Verhinderung von Krankheiten. Allerdings ging es im ehemaligen Gestapo-Untersuchungsgefängnis am Appellhofplatz gerade nicht um menschliche Gemeinschaft. Hier hatte Desinfektion das Ziel, die Haftbedingungen zu verschärfen und die Anzahl der Häftlinge immer weiter vergrößern zu können, ohne die eigenen Beamten oder die Nachbarschaft zu gefährden.
Im Keller des als EL-DE-Haus bekannten Gebäudes waren zwischen 1935 und 1945 tausende Menschen inhaftiert, politische Gegner und ab 1939 immer mehr Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Vor allem in der Endphase des Krieges waren die Haftbedingungen im EL-DE-Haus katastrophal. Auch in den Einzelzellen mit einer Größe von gerade fünf Quadratmetern waren 15 oder mehr Menschen gleichzeitig eingesperrt. Ihre Notdurft verrichteten sie in gemeinsam genutzte Eimer. Waschgelegenheiten gab es nur unregelmäßig.
Unter solchen Bedingungen herrscht eine enorme Seuchengefahr. Den Tod der Häftlinge hätte die Gestapo wohl billigend in Kauf genommen. Allerdings steht das EL-DE-Haus inmitten der Kölner Innenstadt. Eine Seuche hätte nicht nur auf die Gestapoleute übergehen können, sondern auch auf die Nachbarschaft und die Stadt übergreifen können. Also suchte die Gestapo einen Weg, die Seuchengefahr zu bannen, ohne die Überbelegung aufzugeben und die Bedingungen für die Gefangenen verbessern zu müssen.
Als eine Lösung dieses Dilemmas installierte die Gestapo 1943 eine Dusche zur Desinfektion. Den Handapparat setzte sie dafür ein, keimtötende Mittel in den Zellen zu versprühen. Der Apparat war damit Teil des wachsenden Terrors der Gestapo.
Folterwerkzeuge sind oft alltägliche Gegenstände – aber in gegenteiliger Funktion
Seit 1981 ist das ehemalige Gestapo-Gefängnis für Besucher zugänglich. Vor allem die sehr zahlreichen Inschriften an den Zellenwänden legen Zeugnis von Leben und Leiden der Häftlinge ab. Sie ritzten ihre Gedanken und Sorgen mit Nägeln in die Wand und verwendeten Kohle oder Lippenstift. Namen und Herkunft, Protest und Widerstandsgeist, Hoffnung und Sehnsucht, Haft- und Lebensbedingungen, Folter und Verhör, aber auch Abschiedsworte können die Besucherinnen und Besucher von den Wänden ablesen.
Doch erst 20 Jahre später stieß der Leiter der Gedenkstätte bei Umbauarbeiten unter einem Treppenaufgang auf ein etwa 50 Zentimeter großes, metallenes Gerät mit Druckluftventil, Messanzeige und der Markenaufschrift „Mentor“. Recherchen ergaben, dass es sich dabei um einen in den 1940er Jahren weit verbreiteten Desinfektionshandapparat handelte. Seine Bedeutung ergibt sich erst aus der Einordnung in den Kontext des Gefangenenalltags: In der Gedenkstätte des Kölner EL-DE-Hauses steht das Gerät als Beispiel dafür, dass die eigentliche Funktion alltäglicher Gegenstände in ihr Gegenteil verkehrt wurde.
Nach der Gründung des Dokumentationszentrums 1979 und der Einrichtung der Gedenkstätte im ehemaligen Gestapogefängnis, wurden Archiv, Sammlung und Bibliothek ausgebaut, später eine Dauerausstellung entwickelt sowie eine pädagogische Abteilung aufgebaut. Mit über 90.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich ist das EL-DE-Haus heute die meist besuchte Gedenkstätte in Nordrhein-Westfalen. Aktuell wird daran gearbeitet, durch den Einbezug der demnächst freiwerdenden oberen beiden Stockwerke das EL-DE-Haus zu einem „Haus für Erinnerung und Demokratie“ auszubauen.

Köln (Jawne)
„Seid starken Armes, ihr Brüder! Der Heimat / Boden zu hegen, ward euer Teil! Nicht sink‘ euer Mut! Nein, heiter und jubelnd / Kommt, Schulter an Schulter, dem Volke zum Heil!“ Schülerinnnen und Schüler des Reform-Realgymnasium Jawne in Köln haben das Gedicht „Birkat Am“ des jüdischen Nationaldichters Chajim Nachman Bialik im Unterricht kennengelernt. Der Direktor der Schule, Dr. Erich Klibansky, wurde von Nationalsozialisten ermordet. Das Schulgebäude steht heute nicht mehr. Aber eine Kastanie markiert noch heute den ehemaligen Schulhof. Überlebt hat bei vielen auch, was die Jawne unter dem Verfolgungsdruck durch die NS-Herrschaft noch lehrte: Selbstbewusst die jüdische Identität zu leben und fester Teil des gesellschaftlichen Lebens zu sein.
1919 gründete die jüdische Gemeinde Adass Jeschurun in Köln die Jawne, die einzige weiterführende jüdische Schule im Rheinland. Klibansky war 28 Jahre alt, als er 1929 ihr neuer Direktor wurde. In seiner Einführungsrede umriss er seine Überzeugung, an der er bis zum gewaltsamen Ende der Schule festhalten sollte: „Es ist die Aufgabe der jüdischen Schule, harmonisch gebildete Persönlichkeiten zu erziehen, die befähigt sind, wertvolle Glieder des Staates und der menschlichen Gesellschaft überhaupt zu werden.“
Dieses Ideal stellte Klibansky nach 1933 vor große Herausforderungen. Ursprünglich wurde die Jawne vor allem durch Jungen und Mädchen besucht, deren Eltern eine stärkere religiöse Erziehung wünschten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kamen nicht-orthodoxe Schülerinnen und Schüler hinzu. Erich Klibansky bemühte sich, diese Kinder zu integrieren, ohne dabei den speziellen Charakter der Schule aufzugeben.
Mehr und mehr wurde die Jawne zum Schutzraum jüdischen Lebens in Köln. Auf den ersten Blick unterschied sich der Alltag kaum von dem anderer Schulen. Auf dem Hof spielten Kinder Fußball, tobten herum, plauderten miteinander und aßen ihre Pausenbrote. Gleichzeitig bereitete Klibansky seine Schülerinnen und Schüler auf ein Leben außerhalb Deutschlands vor. Er förderte insbesondere den Unterricht in Sprachen wie Englisch, Französisch und modernem Hebräisch.
Nach dem Novemberpogrom 1938 gelang es Klibansky, 130 Kinder und Jugendliche nach England zu retten. Er selbst unterrichtete an der Jawne, bis die Nationalsozialisten die Schule am 30. Juni 1942 schlossen. Drei Wochen später wurde er zusammen mit seiner Familie und über 1.100 weiteren Frauen, Männern und Kindern nach Minsk deportiert und ermordet.
Der Lern- und Gedenkort Jawne hält diese Geschichte lebendig. Die Dauerausstellung „Die Kinder auf dem Schulhof nebenan“ macht den Alltag der ehemaligen Schülerinnen und Schüler greifbar. Schul- und Familienfotos, Zeugnisse, Poesiealben, Tagebücher und Interviews spiegeln die Zerrissenheit zwischen Terror und Alltag, zwischen Vernichtung und der Aufgabe der Heranwachsenden, eine eigene jüdische Identität zu entwickeln.
Unter den Ausstellungsstücken ist auch die Broschüre mit dem Gedicht Bialiks und den Anmerkungen Erich Klibanskys. Mitglieder des Arbeitskreises „Lern- und Gedenkort Jawne“ fanden das Exemplar zufällig im Internet und konnten es in einem israelischen Antiquariat erwerben. In der Publikation begründet Klibansky, warum ausgerechnet „Birkat Am“ für den Schulalltag so wichtig wurde. „Es gibt bedeutendere Gedichte von Chajim Nachman Bialik als seine ‚Birkat Am‘“, schreibt er. Aber dieses Gedicht war besonders beliebt und es drückte auch Klibanskys Bildungsziele aus.

Krefeld
„Kleider machen Leute“, sagt ein altes Sprichwort. Kleidung prägt erste Eindrücke und kann Auskunft geben über gesellschaftliche Stellung, kulturelle Zugehörigkeit oder über Vorlieben beispielsweise für Farben. Dass Menschen mit ihrer Kleidung nicht nur Gruppen zugehören, sondern auch aus ihnen ausgeschlossen werden können, haben die Nationalsozialisten brutal ausgenutzt: Kaum ein Symbol ist so stark mit der Verfolgung der europäischen Juden verbunden wie der gelbe sechszackige Stern, den auch die Krefelderin Lore Gabelin auf ihrer Kleidung tragen musste.
Das schöne blaue Sommerkleid war bei jungen Frauen in den 1930er und 1940er Jahren modern. Darin unterschied sich Lore nicht von den jungen Frauen der Krefelder Stadtgesellschaft. Doch schon kurz nach der Machtübernahme 1933 musste sie als elfjähriges Mädchen lernen, dass sie, ihre kleine Schwester und ihre Eltern aus Sicht der Nationalsozialisten genau aus dieser Stadtgesellschaft ausgeschlossen werden sollten. Ihre Mutter Else war Jüdin.
Lores Vater Friedrich Müller stammte aus einer katholischen Familie und war Inhaber eines Elektrogeschäfts. Nach der Machtübernahme drohte ihm das wirtschaftliche Aus, weil von der NSDAPund der Gestapo Druck auf ihn ausgeübt wurde. Sie verlangten von ihm, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Doch er weigerte sich, blieb bei seiner Familie und damit auch bei Lore. Das Mädchen wurde katholisch getauft, nahm aber auch am jüdischen Religionsunterricht teil.
Die sogenannten „Nürnberger Gesetze“ von 1935 stuften sie fortan als „Mischling ersten Grades“ ein. Als „Mischling“ musste sie den gelben Stern auf ihrer Kleidung zunächst nicht tragen, 1941 wurde er jedoch für alle Juden zur Pflicht. Die Aufschrift „Jude“ zog die hebräische Schrift ins Lächerliche. Eine solche Form der Diskriminierung hatte es in der Moderne bis dahin nicht gegeben, obschon im Mittelalter Juden in ganz Europa gezwungen worden waren, Kleidungsstücke als Erkennungsmerkmale zu tragen.
Nach den ersten Deportationen vom Niederrhein wurde auch für die „Mischlinge“ die Lage immer bedrohlicher.
Lore heiratete 1942 den ebenfalls aus einer katholisch-jüdischen Ehe stammenden Wer-ner Gabelin. Am 17. September 1944 wurden alle in Krefeld lebenden „Halbjuden“ oder mit „Ariern“ verheirateten Juden von der Polizei festgenommen und zu einem Sammelplatz gebracht.
Lore, ihr Mann, ihre Mutter und die Schwester Ilse wurde mit allen anderen zum Schlachthof Düsseldorf transportiert. Das junge Ehepaar hatte zu dem Zeitpunkt bereits einen kleinen Sohn, den sie erst bei Nachbarn, später bei katholischen Verwandten unterbringen konnten – er entging damit der Deportation. Frauen und Männer wurden getrennt. Ihre Mutter und ihre Schwester kamen in ein Arbeitslager der Organisation Todt. Sie hingegen, die damals im 6. Monat schwanger war, wurde aus ungeklärten Gründen der Männergruppe zugeordnet. Über Umwege kam sie nach mehreren Wochen ins Lager Theresienstadt.
Ihr zweiter Sohn Thomas kam dort zur Welt und überlebte wie durch ein Wunder. Auch Lores Schwester, ihr Mann und ihr erstgeborener Sohn konnten überleben. Insgesamt aber 65 Verwandte der Familien Müller und Gabelin im Holocaust ums Leben. Lore Gabelins Mutter verstarb an Typhus, woran sie sich ansteckte, als sie sich unmittelbar nach ihrer Befreiung in Theresienstadt um kranke Häftlinge kümmerte.
Lore Gabelin und ihr Mann kehrten mit Kindern nach Krefeld zurück. Lore wurde Mitglied der neu gegründeten jüdischen Gemeinde und war am Aufbau der NS-Gedenkstätte beteiligt. Sie stiftete zahlreiche persönlichen Gegenständen für die Dauerausstellung „Krefeld und der Nationalsozialismus“ der Gedenkstätte in der Villa Merländer.

Lemgo
Ein besonderes Objekt in der Ausstellung des Frenkel-Hauses ist das alte Widderhorn, das „Schofar“. Die Töne, die der Schofarbläser damit produziert, sind überraschend laut und auch nicht immer wohlklingend, und es stellt sich die Frage nach dem Sinn dieses Rituals.
Zum Einsatz kommt das Schofar am jüdischen Neujahrstag „Rosch HaSchana“ (wörtlich: Kopf des Jahres) – nach jüdischem Kalender am 1. Tischri Ende September. Mit diesem Tag beginnt eine sehr ernst gestimmte Phase von zehn Tagen, in denen die Menschen sich um Versöhnung und Verständigung mit ihren Nächsten bemühen sollen. Ziel ist es, eine Versöhnung mit Gott anzustreben, und die wird erst erreicht, wenn alle zwischenmenschlichen Beziehungen geklärt, Streit beigelegt sowie alle Schulden und Verschuldungen beglichen sind. Erst dann, nach diesen zehn Tagen, wird sich entscheiden, wer in das Buch der Lebenden aufgenommen werden wird, und das ist am Versöhnungstag „Jom Kippur“ (Tag der Sühne). Auch jetzt wird wieder das Schofar geblasen. Der Schofarton ist also ein Weckruf, ein aufrüttelndes Signal, mit dem diese „Hohen Feiertage“ angekündigt und abgeschlossen werden.
Das Schofar ist zusammen mit zwei kleinen Löwenfiguren aus Metall das einzige, was aus der Lemgoer Synagoge erhalten geblieben ist. Der Löwe ist in der jüdischen Geschichte das Symbol des Stammes Juda – eines der Söhne Jakobs, und findet sich in Synagogen häufig als Schmuck auf Tora-Schränken, Tora-Vorhängen und Tora-Schilden.
Zur Ausstattung der Synagoge in Lemgo, die im Oktober 1883 eingeweiht worden war, gehörten ein Toraschrein, fünf Torarollen, zwei Sätze silberner Toraschmuck (also Kronen, Schilde und Zeiger), silberne Weinbecher und Leuchter, Toramäntel und -vorhänge aus Samt, ein Harmonium und vieles andere. Nach dem Pogrom im November 1938 war davon nichts mehr übrig – nur das Schofar und die beiden kleinen Löwen tauchten irgendwann wieder auf. Wer sie an sich genommen hatte, bleibt wohl für immer im Dunkeln.
Szmuel Rubin/Raveh (1925-1987) hatte das Schofar und die kleinen Löwen in den frühen Nachkriegsjahren in Lemgo entdeckt. Geboren und aufgewachsen in Demblin (Polen) war er 1944 als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. Seine Familie wurde ermordet. Nach seiner Befreiung im April 1945 war er in ein Lazarett für die „Displaced Persons“ nach Lemgo gekommen. Im Jahre 1946 hatte er ein Geschäft, u.a. für Haushaltswaren und Küchengeräte eröffnet. Im Rahmen seiner Tätigkeit war er auf die Objekte aus der zerstörten Synagoge aufmerksam geworden.
In Lemgo lernte Szmuel Raveh/Rubin die Holocaust-Überlebende Karla Frenkel kennen. Beide heirateten und wanderten im Jahre 1949 nach Israel aus. Das Schofar und die beiden Löwen nahmen sie mit.
Karla Raveh (1927-2017) war als Tochter der jüdischen Familie Frenkel in Lemgo geboren und aufgewachsen. Zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und ihren beiden Großmüttern war sie am 28. Juli 1942 vom Lemgoer Marktplatz aus in das Ghetto Theresienstadt deportiert worden. Ihre Eltern und Geschwister wurden in Auschwitz ermordet. Nur sie und ihre Großmutter Helene Rosenberg überlebten den Holocaust.
Nach ihrer Befreiung im Frühjahr 1945 war sie nach Lemgo zurückgekehrt. Seit 1949 lebte sie mit ihrem Mann in Israel. Im Jahre 1985 schrieb sie auf Anregung der Lemgoer Lehrerin Hanne Pohlmann ihre Biographie. Das Buch erschien 1986 unter dem Titel „Überleben. Der Leidensweg der jüdischen Familie Frenkel aus Lemgo“. Im Jahre 1988 wurde in ihrem elterlichen Haus die Gedenkstätte Frenkel-Haus eröffnet. Zur Eröffnung brachte Karla Raveh die Löwenfiguren und das Schofar wieder zurück nach Lemgo und übergab sie der Gedenkstätte – als die einzigen erhaltenen Zeugnisse der Einrichtung der Lemgoer Synagoge und als Weck- und Mahnruf für die nachfolgenden Generationen.

Lüdenscheid
In der alten griechischen Sage besiegte Herkules heldenhaft die Hydra. Schlug man der gefährlichen Schlange einen Kopf ab, wuchsen ihr zwei nach. Doch der Halbgott konnte die Halsstümpfe ausbrennen und das Ungeheuer so töten.
Als die NS-Schwesternschaft 1940 einen Neubau für das Lüdenscheider Krankenhaus errichtete, fiel die Wahl nicht zufällig auf diese Geschichte als Wandschmuck über dem neuen Eingangsportal. Das Herkulesmotiv des Künstlers Werner Simon versinnbildlicht den Kampf der nationalsozialistischen Ärzte und Pfleger gegen das Kranke. Was als krank galt, wurde seit der Machtübernahme 1933 durch pseudomedizinische Diagnosen und durch die NS-Weltanschauung festgestellt.
Die NS-Reichsschwestern hatten 1937 die Leitung des Pflegedienstes im städtischen Krankenhaus Lüdenscheid übernommen und setzten fortan ihr menschenverachtendes Bild von Gesundheit und Kranksein rücksichtslos durch. Allein bis Kriegsbeginn wurden dort 204 Menschen zwangssterilisiert, weil sie angeblich unter „Erbkrankheiten“ litten, oder weil sie als Sinti oder Roma nicht ins rassistische Gesellschaftsbild der Nationalsozialisten passten. Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa sollten keine Kinder bekommen. Wurden sie schwanger, brachten Nationalsozialisten und Lagerleiter sie mit Unterstützung von Ärzten zur Zwangsabtreibung ins Lüdenscheider Krankenhaus.
Bei Kriegsbeginn leitete der so genannte Euthanasieerlass die Ermordung von mehr als 200.000 Menschen mit Behinderungen im Deutschen Reich ein. In den besetzten Gebieten fiel ihm ungefähr die gleiche Anzahl zum Opfer. Nachweislich töteten Anstaltsärzte und -pfleger auch 56 Erwachsene und vier Kinder aus Lüdenscheid.
An der medizinischen Verfolgung wirkten viele Behörden mit. Im Sinne der zynisch „Erbgesundheitsgesetz“ genannten neuen Rechtsordnung erteilte das Gesundheitsamt Heiratserlaubnisse, verfolgte Homosexuelle oder leitete Informationen für Zwangssterilisationen an Gerichte weiter. Über Zwangssterilisationen von Insassen in Gefängnissen entschieden nicht die Erbgesundheitsgerichte, sondern die Anstaltsleiter. Die Polizei in Lüdenscheid sperrte an ihrem Dienstort im Alten Rathaus ab 1933 neben kriminellen Verdächtigen rund 700 politische Gegner, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter oder Juden ein. Manche von ihnen wurden weiter in Konzentrationslager oder in „Heilanstalten“ deportiert. Nur ein Teil überlebte die NS-Zeit.
Heute erinnert in den ehemaligen Haftzellen im Alten Rathaus die Ausstellung der Ge-Denk-Zellen an Menschen aus Lüdenscheid, die unter der NS-Verfolgung litten, und an diejenigen, die Widerstand leisteten. Dazu gehören das Schicksal Marianne Dickehuts, die als 19jährige Schülerin nach der Zwangssterilisierung 1943 in Hadamar ermordet wurde, oder das mutige Auftreten Ernst Wilms. Der evangelische Pfarrer aus Lüdenscheid hatte 1941 offen den Behindertenmord kritisiert und wurde als Mitglied der Bekennenden Kirche kurz darauf ins KZ Dachau verschleppt.
Die Ge-Denk-Zellen gibt es nur wegen großen ehrenamtlichen Einsatzes. Diesem Engagement ist es auch zu verdanken, dass das Relief seinen Weg in die Ausstellung gefunden hat. Nachdem der ehemalige Krankenhausbau um 2010 Wohnungsneubauten wich, wussten weder der Bauherr noch zuständige Behörden, wo das Relief aus dem Eingangsportal unterzubringen sei. Engagierte Einzelpersonen aus dem Umfeld der Gedenkstätte kauften es kurzerhand und überreichten es später dem Förderverein der Ge-Denk-Zellen.

Münster
Einen Meter hoch und 80 Zentimeter breit – so groß ist die Leinwand, auf der sich Anatol Herzfeld mit dem Mord an mehr als 30.000 Menschen auseinandersetzt. Auf der Rückseite des Ölgemäldes ist der Titel „Babij Jar im September 1941“ vermerkt. In der Schlucht von Babij Jar bei Kiew ermordeten so genannte Einsatztruppen aus SS und Polizei rund 33.000 Juden. Das Kunstwerk zeigt einen Polizisten, der mit seiner Pistole einen Zivilisten hinrichtet. Im Hintergrund stehen drei Männer, an der grünen Farbe ihrer Uniform ebenfalls als Angehörige der Ordnungspolizei erkennbar.
Anatol Herzfeld beschäftigt sich mit der Rolle der Polizei in der NS-Zeit. Der Künstler ist ein Mann mit einer ungewöhnlichen Biographie. Er arbeitete als Verkehrspolizist und war zugleich Meisterschüler von Joseph Beuys an der Kunstakademie Düsseldorf. Ein Besuch der Ausstellung „Transparenz und Schatten. Düsseldorfer Polizisten zwischen Demokratie und Diktatur“ inspirierte ihn 2008 zu dem Gemälde. Seit 2015 ist es Teil der Dauerausstellung „Geschichte-Gewalt-Gewissen“ in der Villa ten Hompel in Münster.
Der Geschichtsort untersucht den Beitrag von Polizei und Verwaltung am Holocaust und anderen Verbrechen des NS-Regimes. Das gilt besonders für den Einsatz von Polizisten aus dem Rheinland und Westfalen in der Region und in allen Teilen des besetzten Europas. Die Forschung geht davon aus, dass 62% der Holocaustopfer indirekt oder direkt durch uniformierte Polizisten ermordet oder deportiert wurden. Für diese Auseinandersetzung ist die Villa ten Hompel ein besonders geeigneter Ort.
In der einstigen Fabrikantenvilla befand sich ab 1940 die Dienststelle des Befehlshabers der Ordnungspolizei im 6. Wehrkreis, der weitgehend identisch war mit dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens. Nach Kriegsende mussten NS-Verfolgte in die Villa kommen, um eine Entschädigung für erlittenes Unrecht zu beantragen. In den 1950er Jahren war die Villa Sitz des Dezernats für Wiedergutmachung im Regierungsbezirk Münster.
Heute ist die Villa Gedenkstätte und hier hängt das Kunstwerk von Anatol Herzfeld, das sowohl den Tätern als auch den Opfern ein Gesicht gibt. Es hat seinen Platz am Ende der Dauerausstellung gefunden – und das aus besonderem Grund: Am Beispiel der Villa lässt sich bis auf die Ebene konkreter Personen nachvollziehen, wer wann, was und wie entschieden hat, welchen Handlungsspielraum die Beteiligten hatten und wie sie ihn im Einzelfall nutzten. Die Frage nach der Verantwortung eines jeden Einzelnen stellt das Bild in verdichteter Form dar.
Wirkt die dargestellte Szene auf den ersten Blick eindeutig, lässt sie tatsächlich viele Fragen offen: Kniet das Opfer oder steht es aufrecht einige Meter entfernt? Wie verhalten sich die drei Polizisten im Hintergrund? Einer von ihnen wendet sich offenbar ab. Ist er gelangweilt oder will er sich der Erschießung unauffällig entziehen? Die Interpretation liegt letztlich beim Betrachter und sie lässt ihn mit einer entscheidenden Frage zurück: Wie hätte ich mich in dieser Situation verhalten?

Oberhausen
Die sorgfältig gearbeitete und mit feinen Intarsien ausgelegte Holzkiste gelangte 2009 als Schenkung in die Sammlung der Gedenkstätte in Oberhausen. Manfred Kugelmann, ein Oberhausener, der sich mit der VVN schon in den 1980er-Jahren um die Aufarbeitung der Zwangsarbeit in Oberhausen sehr verdient gemacht hat, erhielt sie damals aus der Ukraine. Es ist unbekannt, wer sie, vermutlich in stundenlanger Handarbeit, angefertigt hat. Aber wir wissen, welche Bedeutung diese kleine Truhe hatte, denn sie war ursprünglich der Preis für ein Tauschgeschäft.
Auf solche Geschäfte waren Menschen angewiesen, die von den Nationalsozialisten zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verbracht worden waren. Ihre Arbeit wurde kaum mit Geld entlohnt – im Gegenteil: Sie wurden nur mangelhaft mit Nahrung, Medikamenten und Kleidung versorgt, und ihre Lebensverhältnisse in den Zwangsarbeiterunterkünften waren erbärmlich. „Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, dass sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmögliche Leistung hervorbringen". So hieß es im Programm des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, Fritz Sauckel, im Jahr 1942.
Die Folgen der chronischen Unterernährung waren erhebliche Mangelerscheinungen und vor allem ein drastisches Untergewicht der Häftlinge und Zwangsarbeiter – manche Männer wogen keine 50 kgmehr. Unter solchen Bedingungen litten grundsätzlich alle, aber die Sterblichkeitszahlen waren bei den Häftlingen der Konzentrationslager, bei den Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion und bei den italienischen Militärinternierten (seit dem Zusammenbruch der deutsch-italienischen „Achse“ im September 1943) besonders hoch.
Für die Häftlinge war es lebensnotwendig, heimliche Kontakte zur Zivilbevölkerung zu nutzen, um von Deutschen Lebensmittel zu bekommen. Selten genug steckten Leute den Hungernden Brot zu, ohne etwas dafür zu verlangen – ein Hinweis darauf, dass Teilen der deutschen Bevölkerung die extreme Unterversorgung der Zwangsarbeiter bewusst gewesen sein muss. Andere gaben aber nur bei einer Gegenleistung, und der Tauschhandel mit selbstgefertigten Gebrauchsgegenständen begann zu florieren. Die Polizei schritt hier ein: Kontakte und Tausch seien verboten und „vom volkstumspolitischen Standpunkt höchst unerwünscht“. Verstöße gegen dieses Verbot wurden manchmal drastisch bestraft, und vor allem die als „Untermenschen“ diskriminierten Osteuropäer standen unter ständiger scharfer Beobachtung.
In ihrer Not bastelten und bauten die Häftlinge aus dem, was sie fanden, oft auch nur aus Abfällen, Dinge, die zuweilen sehr hübsch, praktisch oder raffiniert waren und die sie zum Tausch gegen Brot und andere Nahrung anbieten konnten.
Das Intarsienkistchen ist ein berührendes Überbleibsel aus einem der größten Unrechtsgeschehen des Zweiten Weltkriegs. Die nationalsozialistische Gesellschaft allerdings hatte sich an den Alltag des Unrechts über das Kriegsende hinaus gewöhnt. Dass bis 1945 allein im Deutschen Reich insgesamt etwa 13,5 Millionen Menschen Zwangsarbeit leisten mussten, hat im Bewusstsein der meisten Deutschen erst spät zu Einsicht und Verantwortung geführt.

Petershagen
„Herr Ballhaus, wir brauchen die Maschine hier nicht mehr und mitnehmen dürfen wir sie auch nicht. Heben Sie sie für uns auf und falls wir wiederkommen, weiß ich, dass wir sie von Ihnen wiederbekommen!“.
Mit diesen Worten verabschiedete sich Grete Hertz im Sommer 1942 von ihrem Nachbarn in der Fährstraße 6 in Petershagen. Der Schmied Carl Ballhaus war ein Freund der jüdischen Familie Hertz, ihm konnte man vertrauen. Schon knapp vier Jahre zuvor hatte er seine Solidarität unter Beweis gestellt, als er während der antijüdischen Aktionen im November 1938 mutig einschritt und den Brand löschte, der das Haus der Familie Hertz zu vernichten drohte.
Und nun, am 30. Juli 1942, einem Donnerstagabend, brachte Grete Hertz die Brotschneidemaschine, nachdem sie ihren ganzen Haushalt hatte auflösen müssen: Am nächsten Tag sollten sie, ihr Mann Viktor Hertz und ihre Kinder, die Zwillinge Hanni und Siegbert, von Münster aus nach Theresienstadt deportiert werden. Schon ein halbes Jahr zuvor, am Silvesterabend 1941, war der Sohn Erich nach Riga verschleppt worden.
„… und falls wir wiederkommen.“ Ob Grete Hertz wirklich daran glaubte, wieder nach Petershagen zurückzukommen? Sicher ist, dass Grete Hertz mit ihrer Familie über zwei Jahre lang im Ghetto Theresienstadt lebte, bevor sie alle zusammen am 6. Oktober 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort vermutlich sofort ermordet wurden.
Aber die Brotschneidemaschine gibt es immer noch, und dafür sorgte der Schmied Carl Ballhaus. Er verwahrte sie getreulich und vererbte sie an seinen Sohn Karlheinz Ballhaus. Der wiederum gab sie seiner Tochter Anette Ballhaus, die im Jahr 2009 in Oldenburg verstarb. Nun sorgten ihr Lebensgefährte Helmut Ollmetzer und ihre Freunde Dieter Schmidt und Ursula Busse dafür, dass das Erinnerungsstück der Familie Hertz erhalten blieb und nicht auf dem Müll landete – was leicht hätte geschehen können!
Aufmerksam und umsichtig organisierten sie gemeinsam mit Bernhard Brey die Übergabe der Brotschneidemaschine an die jüdische Schule in Petershagen. Helmut Ollmetzer wies dabei darauf hin, dass Carl Ballhaus ein Beispiel und Vorbild für mutiges und solidarisches Handeln gewesen sei und dass es eben auch solche aufrechten Menschen in Petershagen gegeben habe. Und er ergänzte: „Möge dieser Gegenstand für nachfolgende Generationen Mahnung und Verpflichtung sein, dass solche Verbrechen an unseren Mitbürgern in Deutschland nie wieder möglich sein werden".
Heute ist die Brotschneidemaschine ein ganz wichtiges Stück in der Ausstellung der Alten Synagoge Petershagen, weil sie eine Geschichte von Nachbarschaft, von Vertrauen und von der Kraft der Erinnerung erzählen kann.

Selm-Bork
Kaum zu glauben, dass dieses Bauloch eine Bedeutung haben könnte. Aber jede Grabung in den Boden – gleich, ob man ein Haus bauen möchte oder einen Goldschatz sucht – eröffnet die Möglichkeit, eine Entdeckung zu machen. So auch hier. Bei einem Ortstermin mit der Oberen Denkmalbehörde zur Renovierung der über 200 Jahre alten Landsynagoge Selm-Bork kam die Vermutung auf, dass zum Gebäude ursprünglich eine Mikwe gehörte, ein rituelles Tauchbad. Die Suche begann. Im Rahmen einer Projektwoche des örtlichen Gymnasiums entfernten Schülerinnen und Schüler Pflasterstein um Pflasterstein vor dem ehemaligen Hintereingang der Synagoge. Doch Rohre einer Gasleitung schienen alle Überreste zerstört zu haben. Aber den Jugendlichen gelang es, eine Mauer mit der Andeutung einer Treppe in die Tiefe freizulegen. Sollte es sich dabei tatsächlich um die Reste einer solchen Mikwe handeln? Noch ist das Geheimnis nicht endgültig gelüftet, die Denkmalpfleger und Archäologen werten die Funde noch aus.
Eine Mikwe gehört, wie die Schule, der Friedhof und die Synagoge und zu den elementaren Einrichtungen einer jüdischen Gemeinde. Das hebräische Wort „Mikwa“ bedeutet „Wasseransammlung“. Quell-, Grund- oder Regenwasser wird in einem Becken gesammelt und dient der rituellen Reinigung: Für Frauen immer nach der Menstruation, die als „unrein“ gilt, aber auch für Männer, wenn sie sich in irgendeiner Weise rituell verunreinigt haben, zum Beispiel, wenn sie einen Leichnam zur Beerdigung gewaschen und vorbereitet haben, oder bevor sie einen religiösen Text schreiben.
Während heutige Mikwen hell und komfortabel sind, über heiße Dusche zur Vorreinigung, Garderobe und Heizung verfügen, war der Gang in die Mikwe in früherer Zeit, vor allem im Winter, für die Menschen extrem ungemütlich: Sich splitternackt bei Eiseskälte in den dunklen Schacht zu begeben und dort vollständig mehrmals unterzutauchen, damit das reinigende Wasser auch wirklich an jede Stelle des Körpers kommen kann, das Ganze unter Aufsicht einer Badefrau, die die Segenssprüche dazu sagt – das muss durchaus große Überwindung gekostet haben. Glaubensstärke und Pflichtbewusstsein spielte sicherlich auch eine Rolle. Erwiesen ist, dass die besonderen Reinigungsvorschriften im Judentum zu einem wesentlich höheren hygienischen Standard, besserer Gesundheit und höherer Lebenserwartung als in der christlichen Umwelt geführt haben, was diese oft nicht verstanden und als „Bund mit dem Teufel“ gedeutet haben.
Es wäre eine Sensation, wenn sich die Selmer Ausgrabung als Fund einer Mikwe erwiese. Dafür spricht Vieles: Das Längenmaß der baulichen Reste von circa einem Meter in Länge und Breite, die direkte Angrenzung zum Schulraum und zum Aufgang zur Frauenempore in der Synagoge und letztlich auch das Dokument über den Verkauf der Synagoge vom 7. Oktober 1938, in dem notiert ist, dass das „Bethaus Nr. 29 und Nebengebäude“ durch Issak Heumann als Vertreter der Synagogengemeinde an den Nachbarn verkauft wurde.

Siegen
So etwas wie dieses merkwürdige Holztischchen im Aktiven Museum in Siegen kennt man heute nicht mehr. Aber wozu es diente, ist schnell erraten: Für Kinder hat es genau die richtige Höhe, die Platte ist zum Schreiben ein bisschen abgeschrägt. Eine Ablagefläche für Stifte und „Federhalter“, ringsherum Leisten, damit nichts herunterfällt. Unter der Klappe kann man Hefte und Bücher aufbewahren. An alles ist gedacht!
Dieses alte Möbel stammt aus dem Besitz der Familie Fries, die mit zwei Kindern zur Miete im Haus der jüdischen Familie Frank wohnte – nicht die der berühmten Anne, sondern die der unbekannten Inge.
Inge Frank war das Nesthäkchen von Paula und Samuel Frank. Die Eheleute betrieben ein angesehenes Modewarengeschäft, in dem zuweilen mehr als 20 Verkäuferinnen, zwei Dekorateure und mehrere Lehrmädchen arbeiteten.
Als die kleine Inge sechs Jahre alt wurde – im Jahr 1928 – kam sie, wie jedes Kind, in die Schule. Ihre Eltern schenkten ihr einen Schulranzen aus Leder. Die Hausaufgaben machte sie nun an dem kleinen hölzernen Schreibtischchen. Mit dem Wechsel zum Gymnasium im Jahr 1932 war sie dafür aber zu groß geworden. Vielleicht stellte die Familie das Pult auf den Dachboden.
Im September 1933 zog ein junges Ehepaar in das Wohn- und Geschäftshaus der Franks ein. Bald wurden die ersten Kinder von Wilhelm und Ruth Fries geboren, zuerst Klaus, dann Rosemarie. Die Ehepaare waren befreundet, und man kann sich vorstellen, dass Inge manchmal auf die kleinen Nachbarskinder aufpasste.
Aber mit der nationalsozialistischen Machtübernahme änderte sich für Familie Frank bald alles. Inges große Schwester Ruth floh unter dem antijüdischen Druck mit ihrem Mann Herbert im Juli 1938 nach Amerika. Im November desselben Jahres wurden während der antijüdischen Pogrome auch Samuel Frank und sein 22-jähriger Sohn Manfred verhaftet und beide wurden mit Hunderten anderer Männer in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert, um die Familie zur Flucht zu zwingen. Nach der Entlassung wurde Samuel Frank zur Geschäftsaufgabe gezwungen. Dass die nun 16-jährige Inge weiter zur Schule ging, um ihr Abitur zu machen, war unmöglich geworden. Besorgt suchten die Eltern für Inge eine Perspektive. Endlich, im Februar 1939, konnte sie im israelitischen Kinderheim in Köln mit einer Ausbildung zur Kinderpflegerin beginnen. Ihrem Bruder Manfred gelang es im Mai 1939, einen Platz auf dem berühmten Schiff „St. Louis“ zu bekommen, das ihn und andere Flüchtlinge nach einer Irrfahrt bis Mittelamerika schließlich in England von Bord ließ, was seine Rettung war.
Zu Hause mussten die Familien zusammenrücken, denn die neue „arische“ Inhaberin des Geschäfts beanspruchte Wohnraum für sich. Obendrein nahmen die Franks im Frühjahr 1941 noch eine Nichte auf, die fünfzehnjährige Doris Salomon. Für die Nachbarsfamilie Fries war die Wohnung zu eng geworden, denn im Januar war wieder ein Kind geboren worden, um das sich Inge während des Auszugs kümmerte. Zum Abschied schenkte sie dem inzwischen „großen“ Schulkind Klaus Fries ihr Schreibtischchen und dazu den alten Ranzen.
Und was geschah mit den Franks, mit den Eltern, Inge und Doris? Sie bekamen die Nachricht, dass sie sich am Dienstag, den 28. April 1942, am Siegener Bahnhof zum Transport nach Dortmund einzufinden hatten, und sie ahnten, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte. Wie zum Trotz verlobte sich Inge am Vorabend mit ihrem Freund Heinz Lennhoff aus Plettenberg. Wenige Tage später war sie in der ostpolnischen Stadt Zamość, wo sie Zwangsarbeit leisten musste. Ihr letztes Lebenszeichen stammt vom 18. Januar 1943, und vermutlich kam sie bald darauf um – aus Erschöpfung, aus Hunger oder in einer der Gaskammern in Sobibór oder Bełżec.
Ihr kleines Schreibpult aber, und auch den Ranzen, benutzten alle sechs Kinder der Familie Fries, und hätten sie geahnt, welche erschütternde Geschichte sich mit diesen Dingen verbindet, meint Traute Fries heute, wären sie sicherlich viel sorgsamer damit umgegangen.

Soest
1997 betrat Rose Gillet auf Einladung der Geschichtswerkstatt zum ersten Mal die Französische Kapelle in Soest. Sie war die Witwe von Guillume Gillet, der einst als französischer Offizier hier seine Kriegsgefangenschaft erlebt hatte. Verblüfft traf ihr Blick auf ein Gemälde des gekreuzigten Jesus, in dessen Gesichtszügen sie ihren Mann erkannte! Er war einer der Maler in der Französischen Kapelle gewesen, und mit diesem Selbstportrait hat er sich ein persönliches Denkmal gesetzt.
Wie sah der Alltag der Offiziere im Oflag (Offizierslager) aus?
Trotz der Privilegien, die ihnen die Genfer Konvention garantierte, litten die Männer unter den physischen und psychischen Folgen der Kriegsgefangenschaft. Besonders quälend waren dabei die Untätigkeit und das Warten, und als Schande empfanden sie die Tatsache, dass sie in Gefangenschaft geraten waren, ohne in eine wirkliche Kampfhandlung verwickelt gewesen zu sein.
Um die endlos scheinenden Tage sinnvoll zu füllen, waren experimentierfreudige und unternehmungslustige Individualisten gefragt, die ihre Kameraden aufmunterten und inspirierten. Sie organisierten Theateraufführungen, Konzerte und Ausstellungen und luden zu Vorlesungen im universitären Bereich mit seinem anspruchsvollen Bildungsprogramm. Alles dies verdrängte zumindest zeitweise die quälende Langeweile und Ungewissheit der bedrückenden Situation.
Eine Kapelle entsteht
Schon wenige Tage nach ihrer Ankunft am 31. Juli 1940 stellte der Lagerälteste, der französische Priester Oberstleutnant Joseph Collin, bei der deutschen Lagerleitung einen Antrag auf Zuweisung eines Raumes, in dem die katholischen Offiziere das Allerheiligste aufbewahren und Gottesdienste feiern konnten. Denn als Offiziere hatten die Kriegsgefangenen aufgrund des Artikels 16 der Genfer Konvention von 1929 das Recht, ihren Glauben auch praktizieren zu dürfen. Anfang September 1940 bewilligte die Lagerleitung den Antrag Pater Collins und stellte im Block 1 einen weiß gekälkten, nach Westen hin schrägen Dachraum als Kapelle zur Verfügung, nur 7 ½ mal 6 Meter groß. Sie sollte nun dekorativ und würdig ausgestaltet werden.
Dabei half den Offizieren zunächst ein Deutscher, der Gefreite Bernhard Kröger. Er war in der Schreibstube der Kommandantur beschäftigt und versah nebenbei noch den Küsterdienst in der Soester Sankt Patrokli-Gemeinde. Ihm gelang es, Leimfarben zu beschaffen, mit denen die Kapelle nun ausgemalt werden konnte. Gemeinsam mit einem Ministranten, dem späteren Soester Bildhauer und Steinmetzmeister Alfons Düchting, brachte Kröger die Farbeimer ins Lager. Aus Sankt Patrokli sorgte er für die nötigen Kultgegenstände für die Messfeiern. Ob die deutsche Lagerleitung davon wusste, kann heute nicht mehr mit letzter Sicherheit festgestellt werden.
René Vielliard, Feldprediger der Ehrenlegion, legte das ikonografische Programm fest. In Gemeinschaftsarbeit schufen die Künstler der Kapelle ein Interieur, dessen religiöse Motive bis heute ausdrucksvoll und in leuchtenden Farben die Betrachter in den Bann zieht.
Das heute noch existierende Skizzenbuch von Gino Michelin und die erhaltenen Entwürfe von René Coulon sind ein Zeugnis für die Sorgfalt, mit der die Künstler ihr Werk geplant und ausgeführt haben. Die Arbeit war bestimmt von der kreativen Auseinandersetzung und dem Bewusstsein, den Kameraden mit den Darstellungen ein Gefühl von religiöser und innerer geistiger Freiheit zu vermitteln.
Nach wenigen Monaten intensiver Arbeit konnte schon am 20. Dezember 1940 die Einweihung der Kapelle gefeiert werden.

Stukenbrock
„Ich habe das Gefühl, meinen Vater zurückbekommen zu haben.“ 2010 besuchte Dimitrij Kucenko mit seiner Frau Valentina und seinem Sohn Volodimir die Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne. Drei Tage lang fuhren sie mit dem Auto von Odessa bis in die Senne, um endlich Abschied vom seit 1944 als vermisst geltenden Vater Iwan Ustinovich Kucenko zu nehmen. Eine einzige Erinnerung hatte der heute 70jährige Ukrainer an seinen Vater: wie sehr seine Mutter weinte und mit ihm auf dem Arm hinter dem Auto herlief, das den Vater zum Kriegseinsatz abholte. Dessen Schicksal blieb lange ungeklärt.
Erst im Frühjahr 2008 hatte die Suche nach dem Vater ein Ende. Mit Hilfe des Gedenkstättenteams konnte die Familie in Archivunterlagen die letzte Ruhestätte ermitteln. Dimitrij Kucenko brachte Erde vom Grab der Mutter mit und nahm Erde vom Ehrenfriedhof sowjetischer Kriegstoter mit. Die Eltern sollten endlich wieder vereint sein. Die orthodoxe Andacht mit Erzpriester Sergei Ilin hält das Bild fest.
Der 1909 geborene Vater verstarb am 26. Februar 1942, er wurde in einer der 36 Massengräber-reihen verscharrt. Vermutlich bis zu 65.000 sowjetische Kriegsgefangene liegen in diesen Massen-gräbern. Durch ihre Recherchen konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte knapp 16.000 Namen auf dem Ehrenfriedhof zuordnen.
Während des Rundgangs durch die Ausstellung entdeckte Dimitri Kucenko auf einem alten Foto einen weiteren Hinweis auf seinen Vater. Dort ist eine Gruppe von nackten Kriegsgefangenen zu sehen. Der abgemagerte Zustand seines Vaters schockierte Dimtrij Kucenko. Das Foto entstand in der sogenannten „Entlausung“. Dort wurden die Kriegsgefangenen ab 1942 desinfiziert. Diese Pro-zedur empfanden viele Kriegsgefangene als menschenunwürdig. Nach der Entkleidung mussten sich die Kriegsgefangenen gegenseitig sämtliche Körperhaare mit Rasierklingen entfernen.
Seit 1996 gibt es die Gedenkstätte im ehemaligen Arrestgebäude des Stalags 326 (VI K) Senne. Sie wird von einem bereits drei Jahre früher gegründeten Förderverein getragen. Heute gehört neben Forschung und Bildungsarbeit die Schicksalsklärung der Kriegsgefangenen zu den wichtigsten Auf-gaben der Gedenkstätte. Die Einrichtung erreichen fast wöchentlich Suchanfragen. Damit steht das Beispiel von Dimtrij Kucenko stellvertretend für viele Familien, die bis heute noch auf der Suche sind und endlich Klarheit über den Verbleib des Familienangehörigen haben wollen. Die spür-bare Trauer und ebenso die Freude und Dankbarkeit, sich nach Jahrzehnten der Ungewissheit persönlich am Grab verabschieden zu können, ist vielen Angehörigen sehr wichtig.
Die Geschichte Dimtrij Kucenkos ist eine von insgesamt fünf Geschichten in der Dauerausstellung. Sie verdeutlichen, dass die Gedenkstätte neben ihrem erinnerungskulturellen Auftrag buchstäblich ein Ort für persönliches Gedenken ist. Denn hinter jedem Kriegstoten steckt ein familiäres Schicksal. In allen Lebensbereichen ist der Verlust zu spüren und prägt bis heute die Lebensgeschichten der Angehörigen.

Als Ausdruck einer Gesinnung oder eines Lebensmottos, um die Verbundenheit mit einer Rockband oder einer Automarke zu zeigen: Anstecknadeln und Abzeichen, Buttons und Pins sind in unserer Alltagskultur kaum zu übersehen. Sie werden als Schmuckstücke getragen oder signalisieren öffentlich und – auf der Kleidung, an einer Tasche oder an einem Rucksack befestigt – deutlich sichtbar die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zu einem Unternehmen, zu einer Partei, zu einem Verein oder Verband. Sie erinnern an ein bestimmtes Ereignis oder an eine Veranstaltung, sie drücken ganz einfach eine Vorliebe oder Abneigung aus – oder sie vermitteln kurze politische Botschaften.
Auch die in der Dauerausstellung der NS-Dokumentation Vogelsang gezeigte Anstecknadel erfüllte derartige Funktionen. Wer sie sich Ende der 1970er Jahre ans Revers steckte, trug damit seine Vergangenheit als ehemaliger "Ordensjunker" der NSDAP öffentlich zur Schau und zählte sich mit Stolz zum Kreis der "alten Kameraden" aus den NS-Ordensburgen. Der Anstecker signalisierte somit vor allem ideelle Identifikation. Er verklärte in gewisser Weise zugleich auch die Vergangenheit, denn gezeigt ist die von den Nationalsozialisten ikonenhaft verwendete und in der Propaganda reichsweit verbreitete Ansicht der NS-Ordensburg Vogelsang, während die drei Buchstaben K, V und S für die Namen der drei "Ordensburgen" Krössinsee, Vogelsang und Sonthofen stehen.
Als repräsentative Großbauten mit erheblichem Aufwand ab 1934 neu errichtet, dienten die drei NS-Ordensburgen der NSDAP zum einen als Kaderschmieden, in denen jüngere nationalsozialistische Aktivisten, sogenannte "Ordensjunker", auf ihre Aufgaben als politische Funktionäre der "rassisch" homogen gedachten "Volksgemeinschaft" vorbereitet werden sollten. Diese imaginierte künftige Führungsschicht wurde elitär konstruiert, ideologisch geschult und sollte der Sicherung und dem Ausbau der NS-Herrschaft dienen. Zum anderen erfüllten die drei "Ordensburgen" multifunktionale Zwecke: Die NSDAP und ihre Unterorganisationen nutzen sie wie Tagungshotels, als Versammlungsstätten, als Propagandaplattformen und politische Bühnen ihrer Selbstdarstellung.
Auch wenn die Ausbildung an den NS-Ordensburgen als gescheitertes Konzept betrachtet werden darf, wurden doch zahlreiche der ca. 2.100 "Ordensjunker" und das an den "Ordensburgen" eingesetzte Lehr- und Stammkorps ab 1939 als politisches Herrschaftspersonal in der Zivilverwaltung der eroberten Gebiete Osteuropas eingesetzt – in Polen, vor allem aber in der Ukraine, in Belarus und auch im Baltikum. Viele von ihnen beteiligten sich als Täter und Mittäter an den deutschen Verbrechen, sei es bei der Ausplünderung der Länder, der Selektion von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern oder der Bildung und Verwaltung von Ghettos einschließlich der Ermordung der jüdischen Bevölkerung im Zuge der Massenerschießungen.
In der Bundesrepublik organisierten sich die ehemaligen "Ordensjunker" – von den Strafverfolgungsbehörden nur wenig beachtet – in den 1950er Jahren in einem Netzwerk, dem sie die Bezeichnung "Alteburger Kreis" gaben – ein Wortspiel, das auf die "alten Kameraden" und die NS-Ordensburgen verweist. Die Anstecknadel schließlich diente bei ihren Treffen bis Ende der 1990er Jahre als Erkennungszeichen.
Die bis 2005 als Truppenübungsplatz der belgischen Streikkräfte genutzte ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang ist als Lern- und Erinnerungsort seit 2006 der Öffentlichkeit zugänglich. Sukzessive wurden das pädagogische Programm sowie Archiv, Sammlung und Bibliothek aufgebaut. Die Dauerausstellung der NS-Dokumentation Vogelsang konnte 2016 eröffnet werden. Rund 270.000 Besucherinnen und Besuchern besuchen heute jährlich den Internationalen Platz Vogelsang IP.

Wewelsburg
Diese gestreifte Häftlingsjacke aus blau-weiß gestreiftem Baumwolldrillich gehörte Max Schubert, der 1940 in das KZ Niederhagen/Wewelsburg deportiert wurde und bis zur Auflösung des Konzentrationslagers im Frühjahr 1943 meist in der Kleiderkammer arbeitete. Er blieb mit rund 40 Häftlingen in Wewelsburg. Dieses sogenannte Restkommando war als Außenkommando Wewelsburg dem KZ Buchenwald unterstellt. Die hohe Häftlingsnummer 13598 verweist auf diese Zugehörigkeit. Max Schubert trug als Angehöriger der Zeugen Jehovas (Ernste Bibelforscher) den lila Winkel.
Schubert wurde 1937 wegen illegaler Betätigung für die Internationale Bibelforscher Vereinigung verhaftet. Nach einem Jahr Haftzeit im Gefängnis in Bautzen wurde er 1938 ins KZ Buchenwald eingewiesen. Von dort kam er 1940 nach Wewelsburg. Nach seiner Befreiung am 2. April 1945 zog er wieder in seine Heimat und wurde Gruppendiener bei den Zeugen Jehovas. 1950 wurde er deswegen verhaftet und nach DDR-Recht zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Freilassung 1957 siedelte er in die Bundesrepublik über. Er starb September 1979.
Das Einkleiden nach ihrer Ankunft im Konzentrationslager war für die neuen Häftlinge schockierend und demütigend. In den „Zebra-gestreiften“ Uniformen sollten die Häftlinge wie Strafgefangene aussehen. Durch die schlecht sitzenden, häufig schadhaften Kleidungsstücke machte die SS sie optisch genau zu den „Untermenschen“, die sie bekämpfen wollte. Demgegenüber präsentierten sich die SS-Wachleute in ihren tadellosen, körperbetonten Uniformen als „Herrenmenschen“. Mit ihren Zivilkleidern gaben die Eingelieferten ihren persönlichen Namen ab und wurden zu einer Nummer in der Masse der Gefangenen.
1938 führte die Inspektion der Konzentrationslager die einheitliche, gestreifte Kleidung im nationalsozialistischen KZ-System ein. Während die Sommerkleidung aus Baumwolldrillich genäht war, bestand die Winterkleidung aus kratzender, schlecht trocknender Reißwolle (Gemisch aus wenig Wolle, Viskose und Baumwolle).
Die farbigen Stoffdreiecke, sogenannte Winkel, auf der Vorderseite der Häftlingsjacken kennzeichneten die Einteilung der Häftlinge in Kategorien. Politische Häftlinge erhielten ein rotes Dreieck, kriminelle Häftlinge ein grünes, als „asozial“ bezeichnete Häftlinge bekamen einen schwarzen Winkel, Bibelforscher einen lila Winkel. Mit dieser Einteilung in Kategorien entwickelte die SS ein System der sozialen und rassenideologischen Differenzierung der Lagerbelegschaft.
Die Häftlingsjacke hatte Wettin Müller, Mitglied des Restkommandos, zusammen mit weiteren Kleidungsstücken nach dem Krieg mit in seine Heimat genommen. Für ihn war die Kleidung vermutlich nicht nur ein persönliches Erinnerungsstück, sondern auch von symbolischer Bedeutung als Zeugnis seiner Leidenszeit.
Nach seinem Tod 1998 überreichte sein Sohn dem Kreismuseum Wewelsburg das einzigartige Konvolut. Denn nur selten können überlieferte Kleidungsstücke aus den Konzentrationslagern zweifelsfrei einzelnen Häftlingen zugeordnet werden. Nach behutsamer Restaurierung werden die Kleidungsstücke nun in der Dauerausstellung „Ideologie und Terror der SS“, der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933–1945 gezeigt. Es wird dabei Wert darauf gelegt, die Kleidung nicht als unnahbare Reliquien der Opfer von SS-Gewalt auszustellen, da eine „sakralisierte“ Präsentation der Relikte den analytischen Blick verstellen würde. So blieben bei der Restaurierung Tragespuren und Risse extra erhalten. Die Kleidung wird mit Erinnerungsberichten von Überlebenden aus dem Lageralltag verknüpft, um so die materielle und hygienische Versorgung der Häftlinge zu erläutern.

Windeck-Rosbach
Nur drei Kleiderbügel blieben von einem erfolgreichen jüdischen Textilkaufhaus in Rosbach. Den jüdischen Inhaber Wilhelm Seligmann enteigneten die Nationalsozialisten, bevor sie ihn und seine Familie deportierten und ermordeten. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts lebten die Vorfahren von Willi, wie Wilhelm Seligmann genannt wurde, in Rosbach. Eines der ersten Familienmitglieder, der Metzgermeister Moses Seligmann (1853-1931), war 1888 maßgeblich an der Gründung der Rosbacher Synagogengemeinde beteiligt. Willi Seligmann wurde als einer von vier Söhnen von Moses 1882 geboren. Er betrieb als gelernter Kaufmann zusammen mit seiner Frau Johanna ein Textilwarengeschäft. Ende der 1920er-Jahre ließ Willi einen Neubau in der Rosbacher Kirchstraße errichten. Trotz der wirtschaftlichen Krisenzeit entwickelte sich das Textilwarengeschäft zum größten am Platz. Die Kunden kamen aus der gesamten Region. Das Geschäft war auch samstags und oft sonntags für einige Stunden geöffnet. Bis zu drei Angestellte beschäftigte Willi.
Auch das Kaufhaus Seligmann war im Dezember 1934 vom Boykott betroffen. Käuferinnen und Käufer wurden von Posten in Zivilkleidung vom Betreten des Geschäfts abgehalten. Als der Rosbacher Bürgermeister um Hilfe gebeten wurde, lehnte dieser entschieden ab. Trotz der wirtschaftlich schlechten Situation, der ausgebliebenen Hilfe und der NS-Propaganda konnte Willi Seligmann seinen Umsatz sogar steigern, wie amtliche „Stimmungsberichte“ für den Siegburger Landrat im Juli 1935 feststellten. Denn der jüdische Kaufmann hatte das größte und beste Angebot in der Region.
Am Abend des 10. November 1938 zerstörte eine Gruppe SA-Männer das Geschäft im Zuge der Novemberpogrome. Willi Seligmann wurde wie die anderen jüdische Männer aus Rosbach in das KZ Dachau verbracht, das Geschäft kurze Zeit später an einen Rosbacher Konkurrenten „verkauft“. Nach der Rückkehr aus Dachau zog Willi mit Frau und den beiden Kindern Artur und Ruth in ein so genanntes Judenhaus nach Köln um. Am 7. Dezember 1941 wurde die gesamte Familie nach Riga deportiert, Artur später noch ins Konzentrationslager Stutthof, wo er sein Leben ließ; Eltern und Schwester gelten als verschollen.
Als die 1994 eröffnete Gedenkstätte im ehemaligen Wohnhaus der Familie in Planung war, übergab Mariana Pissani der Einrichtung 1993 zwei Kleiderbügel. Sie war die in Argentinien geborene Großnichte von Willi. Die Bügel tragen die Aufschrift „Willy Seligmann, Rosbach (Sieg)“. Einer der zwei Kleiderbügel trägt den handschriftlichen Vermerk „1938“. Alfred Seligmann, Willis Neffe und Mariana Pissanis Vater, und seine Ehefrau Hilde hatten sie als Erinnerungs- wie auch Gebrauchsstücke im Oktober 1938 bei ihrer Auswanderung mit nach Argentinien genommen. Später erhielt die Gedenkstätte von einem Rosbacher Bürger einen weiteren Kleiderbügel. Auf diesem ist der Name von „Willy Seligmann“ mit Bleistift durchgestrichen – möglicherweise wollte der Besitzer den jüdischen Namen im „Dritten Reich“ tilgen. Heute sind die Kleiderbügel ein Zeugnis des ehemals blühenden jüdischen Geschäftslebens in Rosbach und verweisen zugleich auf dessen Vernichtung durch die Nationalsozialisten.

Wuppertal
Das Milchkännchen aus weißem Porzellan wird keinen Kaffeetisch mehr zieren: Es ist zerbrochen. Warum hat sein Eigentümer die Scherben nicht in den Müll geworfen, sondern, ganz im Gegenteil, sorgsam aufbewahrt?
Der Stempel auf dem Boden des Kännchens gibt Aufschluss: „KPM“ ist dort zu lesen, und das war das Zeichen der „Königlichen Porzellan Manufactur“ in Berlin. Das Kännchen ist ein Stück „Judenporzellan“.
Es stammt aus dem Besitz der jüdischen Familie Treistmann aus Lublin in Polen. Moritz Treistmann zog Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland, heiratete eine junge Frau aus Meinerzhagen und ließ sich schließlich mit ihr und drei Töchtern im Wuppertal nieder. Immer im Gepäck dabei: Das „Judenporzellan“.
Vermutlich mehr als 100 Jahre zuvor hatten Moritz Vorfahren das Kännchen vermutlich einem jüdischen Bekannten aus Preußen abgekauft, der Opfer einer der antijüdischen Gesetze dort geworden war. Im Jahr 1769 nämlich hatte der preußische König Friedrich II verfügt, dass die Juden in seinem Staat bei bestimmten Anlässen (z.B. vor Erteilung eines Schutzbriefes, also einer Art Aufenthaltsgenehmigung) eine große Menge seines Porzellans kaufen und im Ausland absetzen mussten. Ob man das Geschirr oder die Figuren, die auch massenhaft produziert wurden, gebrauchen konnte oder schön fand, stand dabei gar nicht zur Diskussion. Das war eine von vielen Schikanen des „aufgeklärten“ Königs, mit der er seine Abneigung gegen die Juden ausdrückte, Profit aus ihnen schlagen und sie zur Abwanderung nötigen wollte. Das Porzellan aus der königlichen Produktion war minderwertig, und als es sich in Europa verbreitete, nannte man es bald nur noch abschätzig „Judenporzellan“.
Stephen Gruneberg, der heute in London lebt, hat das Milchkännchen und auch noch eine wuchtige Kaffeekanne mit dem Zeichen „KPM“ zur Erinnerung an seine Großeltern aufbewahrt. Im Sommer 2018 hat er es der Begegnungsstätte Alte Synagoge für die Dauerausstellung geschenkt. Sein Großvater Moritz Treistmann starb 1939 in Lublin an einer nicht behandelten Blutvergiftung. Seine Großmutter Hedwig wurde 1941 im Vernichtungslager Majdanek ermordet.
Die Ausstellung in der Begegnungsstätte Alte Synagoge nimmt nicht nur die 12 Jahre der nationalsozialistischen Judenverfolgung in den Blick, sondern macht einen Längsschnitt durch die jüdische Geschichte der Region von den ersten vorhandenen Spuren bis in die Gegenwart. Deshalb sind auch Objekte wie dieses Milchkännchen so bedeutend, weil es auf die unsichere Lebenswelt der Juden lange vor der Zeit des Nationalsozialismus verweist, zugleich aber auch bis in die Gegenwart.